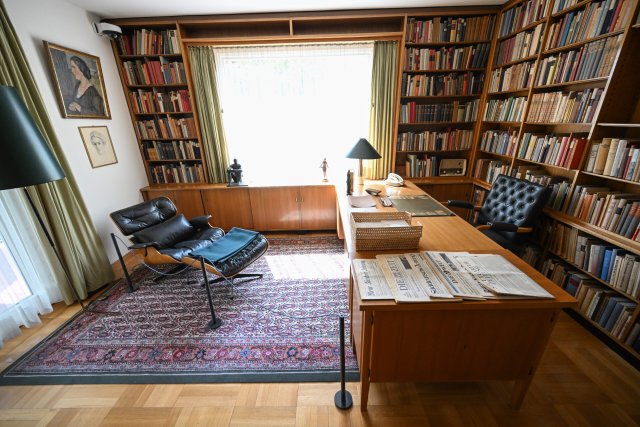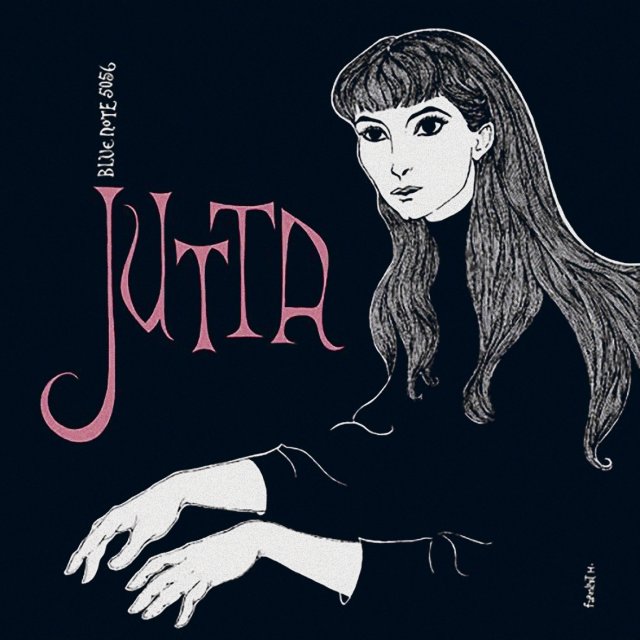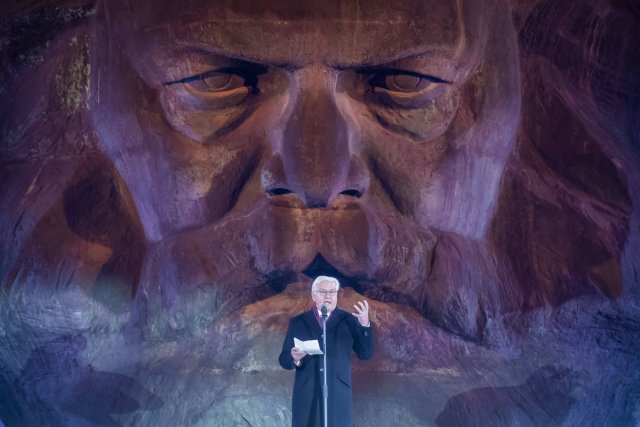- Kultur
- DIE KRISE DER WELTORGANISATION
Ist die UNO reformierbar? – Skepsis ist angebracht
Dieses Jahr wird die UNO 50 Jahre alt. Fast alle sind sich einig, daß eine Reform der Weltorganisation nötig wäre. Aber wie soll sie aussehen? Wer soll sie bewerkstelligen? Ist sie überhaupt möglich? Verkommt die UNO nicht zu einem Komplott der kapitalistischen Mächte unter Führung der USA gegen die übrige Welt? Macht es Sinn, über Reformkonzepte nachzudenken? Die zwei Bücher sind als ein Beitrag zur Diskussion zu verstehen.
Für Ernst-Otto Czempiels Arbeit ist der Untertitel wegweisend: „Möglichkeiten und Mißverständnisse“. Er warnt davor, in der UNO eine „Quasi-Weltregierung“ zu sehen. Das System der kollektiven Sicherheit - so wie es in der Charta konzipiert ist - sei ein „Mythos“ Es laufe auf ein „Sicherheitsdilemma“ hinaus: Entweder ist es unanwendbar, weil die großen Mächte sein Funktionieren nicht wollen und verhindern. Oder es ist überflüssig, weil Sicherheit durch Übereinstimmung der Interessen der Großmächte ohnehin gewährleistet ist. Die Möglichkeiten sieht er in einer ganz anders praktizierten internationalen Kooperation als ein Mittel, um das Sicherheitsdilemma zu reduzieren oder ab-
zubauen. Die Demokratisierung der Herrschaftssysteme der Systemmitglieder sei eine wesentliche Gewährleistung von Sicherheit. „Anfang der neunziger Jahre gilt es als empirisch erwiesen, daß Demokratien untereinander keinen Krieg geführt haben.“ (S. 41) Dem wäre hinzuzufügen, daß Demokratien je nach Interessenlage umso kräftiger Militäraktionen gegen andere praktiziert haben.
Der Verfasser hat eine kritische Sicht auf Kapitel VII der UN-Charta (Maßnahmen bei Bedrohung oder .Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen). Er setzt eher darauf, Gewalt zu verhüten statt zu bestrafen (S. 40) und macht Vorschläge, das „peace-keeping“ auszubauen. „Mit Gewalt von außen in Bürgerkriege zu intervenieren, kann als aussichtslos gelten.“ (S. 110) Dem ist beizupflichten. Czempiel setzt auf Gewaltvorbeugung und auf gewaltfreie Konfliktbearbeitung. „Und nur wenn und wo diese beiden Strategien versagen, muß man prüfen, ob ein Gewalteinsatz etwas ausrichten kann und was. Die Gewalt ist wirklich nur die ultima ratio, an die erst gedacht werden sollte, wenn alles andere versagt hat. Gegenwärtig aber
Ernst-Otto Czempiel: Die Reform der UNO. Möglichkeiten und Mißverständnisse. C. H. Beck, München 1994.200S., br, 19,80DM.
Klaus Hüfner (Hg.): Die Reform der Vereinten Nationen. Die Weltorganisation zwischen Krise und Erneuerung, Leske + Budrich, Opladen 1994. 365 S., br., 48 DM.
gilt sie wieder als prima und optima ratio, als diejenige Strategie, die nicht nur die erste, sondern auch die beste ist.“ (S. 111) Aber: Wer prüft und wer entscheidet, ob ein ultima-ratio-Fall vorliegt?
Zur Reform der UNO hat der Verfasser ein realistische Konzept: Möglichst viele vernünftige Veränderungen ohne Revision der Charta. Er meint: „Wer die Vereinten Nationen reformieren will, muß die Außenpolitik ihrer Mitglieder reformieren.“ (S. 176)
Das zweite Buch ist ein interessanter Sammelband, in dem aus unterschiedlichen Sichten, aber durchweg kritisch, wesentliche Probleme aus Vergangenheit und Gegenwart der UNO abgehandelt und Reformideen mit und ohne Änderung der Charta unter-
breitet werden. Sein Reiz besteht nicht zuletzt darin, daß neben jüngeren Autoren gestandene Wissenschaftler und Praktiker aus der BRD und der DDR zu Wort kommen.
Der Friedensforscher Ulrich Albrecht von der Freien Universität Berlin äußert sich in Zusammenarbeit mit Bernhard Neugebauer, weiland Stellvertreter des Außenministers der DDR, über friedenspolitische Aspekte einer UNO-Reform. Der Herausgeber Klaus Hüfner von der FU und Wolfgang Spröte, ehemals Institut für internationale Beziehungen Potsdam-Babelsberg, sind mit einer Koproduktion zur Reform des Wirtschafts- und Sozialbereichs der UNO vertreten. Unter den Verfassern finden sich der Völkerrechtler Bernhard Gräfrath von der Akademie der Wissenschaften der DDR, vormals Mitglied der Völkerrechtskommission der UNO und Siegfried Zachmann, Vertreter der DDR bei der UNO bis 1990 ebenso wie Klaus Dikke von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und Helmut Volger aus Berlin (West), bekannt aus vielen Veröffentlichungen zur UNO. Ein Nachhall oder sogar ein Vorzeichen, daß Leute, die früher
von der entgegengesetzten Seite der Barrikade aus Kooperation im Interesse von Frieden und Verständigung praktisch geübt haben, dies auch heute nicht verleugnen wollen? Selbstverständlich sind die Kollegen Ost im Unterschied zu den Kollegen West „abgewikkelt“ und auf Strafrente gesetzt.
Die Themenpalette ist zu breit, um hier auf Einzelheiten einzugehen. Zum Thema „Deutschland und die Vereinten Nationen“ vermerkt Ulrich Albrecht, das Bild der Rolle des vereinigten Deutschland in der UNO bleibe vorerst weitgehend unscharf. Das gilt für den zivilen Beitrag der BRD zur UNO. Was das militärische Engagement betrifft, ist das vereinigte Deutschland inzwischen zu allem bereit, was seinem Großmachtstreben dient. Auch der Anspruch auf ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat mit Vetorecht ist gestellt, obgleich die Trauben wohl zu hoch hängen.
Auch die Verfasser dieses Buches diagnostizieren die „Krise der Weltorganisation“ als ziemlich schlimm. In bezug auf die „Erneuerung“ der UNO herrscht Skepsis vor. Wohl zu Recht. GREGOR SCHIRMER
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.