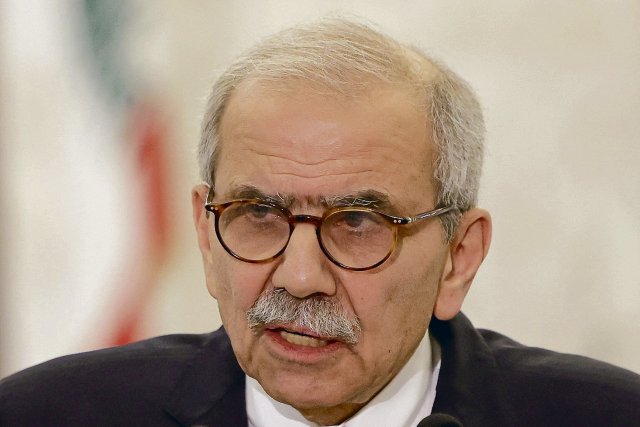- Politik
- Morgen im Hörfunk: Szenen einer Familie in Niederbayern
«Mein Sohn, der Nazi»
Reinhard Schneider, 1952 in Gelsenkirchen geboren, ist Autor von Hör funkfeatures, Dokumentarfilmen und Fernsehreportagen. Seine jüngste Arbeit heißt «Mein Sohn, der Nazi». Schon vorab sprachen Redakteure, die das Feature produzierten (SFB-ORB, WDR), von einem «außergewöhnlichen Stück». Sie haben Recht: Selten gelingt solche Ver trautheit zwischen Journalist und denen, über die er reportiert, selten solche Intimität, bei der alle Beteiligten das Mikrofon schließlich vergessen. Schneider, der vorübergehend gleichsam in der Familie lebte, konnte deren «Innenansicht» aus 0- Tönen zusammenfügen.
Susanne Sommer lebt in Niederbayern und ist Krankenschwester. Schneider begegnete ihr erstmals am Rande einer Demonstration von Rechtsradikalen. Sie stand mit einem Schild «Nazis raus!» bei den Gegendemonstranten, zeigte auf einen grölenden Skindhead und sagte: «Das ist mein Sohn.»
Ihr Sohn: der 17-jährige Simon. Massig, aggressiv, fanatisch. In seinem Zimmer, das einer Zelle gleicht, Propagandaplakate des Dritten Reiches, Fotos von Hitler, umgeben von SA- oder SS-Leuten. «Danzig», «Breslau» und «Stettin» sind für Simon «deutsche Städte und nicht irgendwie was Polackisches». Und wenn es noch einmal zum Krieg käme, wäre er nicht an der Front, sondern «in der Totenkopf-SS und würde in KZ-Lagern aufpassen».
Simon wohnt noch bei seiner Mutter und deren zweitem Ehemann Franz. Widerwillig. Er hat drei Lehren abgebrochen, ist arbeitslos. Schneider macht uns zu Zeugen des häuslichen Lebens: Gespräche beim Mittagessen, in der Küche beim Abwaschen, mit Simon in dessen Zimmer, mit Susanne und Franz allein. Gespräche? Wo der Sohn auf die Mutter trifft, wird der Wort- zum Schlagabtausch. Fast immer kommt es zur Eskalation. Simon: «Halts Maul, wenn ich mit dir rede!» Oder: «Was meine Mutter auch liebend gern tut, ist, wenn sie im Fernsehen was sieht, rennt sie in mein Zimmer und scheißt mich zusammen... Und dann würd› ich am liebsten gleich die Knarre nehmen und ihr eine Kugel durch den Kopf schießen.» Er würde auch «irre gern, wenn wirklich mal wieder so ein Diktator kommt, bei dem mitreden und dafür sor gen, dass die in Dachau oder sonst ir gendwo reinkommt».
Szenen einer Familie. Hass, Gebrüll, Tränen - Hilflosigkeit. Franz: «Die Susanne weiß halt manchmal nicht um das, was geht, was der Simon wissen will. Und von ihr ist das eigentlich das Sticheln, ist das eigentlich ein Umspielen, weil sie s nicht weiß und ihm nicht die richtige Antwort geben kann ... Meines Erachtens nach ist aber Nichtwissen nicht, dass man dumm ist, sondern man weiß nicht, man kann nicht alles wissen.»
Susanne ist nicht dumm. Ihr geht es wie tausenden anderen Müttern, denen die Söhne entglitten sind: Sie spürt, dass kein Argument, keine Logik gegen den Hass des Sohnes ankommt. Sie kennt die Ursachen dieses Hasses, «aber Simon kennt sie nicht». Und sie können nicht miteinander reden. Nicht über den Vater, einen Seemann, der Susanne oft ohne Geld sitzen ließ, nicht über die latente Gewalt, die ihre Familie zerstörte. Schon gar nicht darüber, wie Susanne und vor allem Simon darunter litten. Simon, der als Kind kaum sprach, im Kindergarten gequält wurde, möchte aufs Grab des Vaters «pissen». Susanne, die in die Nachtschicht ging, um sie beide durchzubringen, wirft er vor- «Du bist ja nie dagewesen.» Er weiß, dass er sie damit trifft, der Satz macht ihr ein schlechtes Gewissen. Es setzt Watschen, man zeigt einander an: Eine Kripobeamtin sagt Susanne, sie habe noch nie so ein großes Kind nach Liebe schreien sehen. Susanne: «Da haben Sie schon Recht. Aber wissen Sie, vor zwei Tagen habe ich seine Springerstiefel zwei Zentimeter vor meinem Gesicht gehabt. Also, was soll ich machen? Meine Liebe will er nicht.» Sie stecken fest in dem Dilemma. Susanne hat sich abgefunden: «Andere haben körper behinderte Kinder, ich hab so ein Kind. Was soll‹s?» Sie hofft nur, dass Simon keinen totschlägt, «sondern nur verletzen tut» ... Wäre «Mein Sohn, der Nazi» ein Hör spiel, würde man vielleicht denken: Nicht schlecht. Was man über den Hintergrund junger Rechtsradikaler weiß, hat der Autor gut umgesetzt - natürlich hat er hier und da dramaturgisch zugespitzt.
Als Dokument scheint «Mein Sohn, der Nazi» fast zu perfekt, um wahr zu sein - als Dokument ist es schockierend.
Auch weil so ein Feature vor einigen Jahren noch «Mein Vater, der Nazi» geheißen hätte. Und weil es einen an Filme erinnert, die man sah, als man ein Kind war. Die gegenseitige Denunziation: Damals hieß es, die Ideologie der Nazis wirkte bis in die Familien, zersetzte und zerstörte sie. Heute bin ich geneigt zu glauben, dass in die Familien lediglich zurückkehrte, was angelegt war. Ist es denk bar, dass ›33 halb Deutschland familiär zerrüttet war? Wieso nicht? Und wieso sollte es anders sein in unseren Tagen? Womöglich ist Zerrüttung ja der normale Aggregatzustand von Familie?
Heute lässt man sich scheiden, und die Raten stützen diese Annahme. Wenn es so ist, kann man einerseits über Therapien nachdenken (soziale Not macht Familien nicht besser, und wenn die Mutter nicht helfen kann, können es vielleicht andere), andererseits sollte man wissen, dass faschistische Ideologie (oder wie immer sie sich nennt) eine ständige Option ist. Weil es immer Leute geben wird, die sich ihr Heil davon versprechen.
Ein Irrglaube, etwas sei je vorbei. Hört man genau hin, hört man dies und mehr in Schneiders O-Tönen. Und bleibt letztlich ratlos zurück. Genau so ratlos wie Mutter Susanne. Man ahnt nur, dass man gefor dert ist, den wahnwitzigen Überhebungskonstrukten Tauglicheres entgegenzusetzen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.