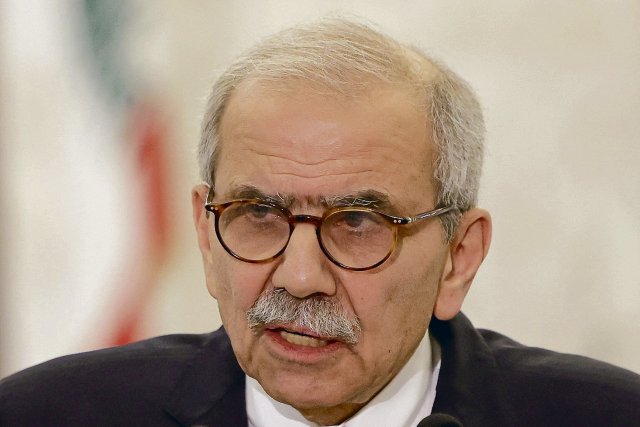- Politik
- Thomas Langhoff inszenierte »Die Möwe« am DT
Tragödie mit und ohne Optimismus
Melancholie? Ja, aber eine in Anklängen, keine, die sich penetrant zelebriert. Das ist der Stil, in dem Langhoff Tschechow inszeniert, der Stil auch, in dem er Abschied von seinem Deutschen Theater nimmt: großer Stil.
«Die Möwe» ist Langhoffs vorletzte Inszenierung an diesem so schwierigen Berliner Haus (es folgt noch «König Lear»), dem er jetzt über ein Jahrzehnt vor steht. Symbolträchtige Abschiedsstimmung. Versäumte Aufbrüche in den zurückliegenden Jahren? Viele. «Die Möwe» von Anton Tschechow ist ein Stück auch über diese hauseigene Situation.
Die erste Szene ist gleich eine Schlüsselszene: Kostja Treplew (ganz unneurotisch um seine Unabhängigkeit von der Mutter streitend: Roman S. Pauls), ein junger Avantgarde-Dichter und Sohn der alternden Schauspielerin Arkadina, lässt die junge Nachbarstochter Nina im Sommer Gartentheater sein symbolistisches Stück vortragen. Bei Langhoff steht Treplews «Neues Theater» als ernsthafte Herausforderung im Räume. Arkadina (Dagmar Manzel) und ihre Sommergesellschaft lagern auf einer die gesamte Bühnenbreite einnehmenden Bank, mit dem Rücken zum Publikum, und der deklamierenden Nina zugewandt. Sie, diese Zuschauer, sind hier diejenigen, die das eigentlich abgründig-absurde Theater aufführen, mit Unterhaltung suchenden Händen auf dem Rücken des Sitznachbarn, mit Langeweile verratendem Gliederwerfen und unpassenden Zwischenrufen. Man lümmelt sich wie vorm Fernseher, dreist gekränkt, wenn dort statt der gewohnten Vorabendserie ein das Wohlbefinden störender Film von Fassbinder läuft.
Wir sehen lauter autistisch ihrem Traum hinterher Rennende und ebenso autistisch ihren verlorenen Träumen Nachtrauernde. Nur gelegentlich schrecken sie auf. Für Sekunden fällt der Arkadina ein: sie hat einen Sohn, den sie liebtum sogleich wieder zurückzugleiten in die ewige Selbstumkreisung, die eitle Selbstinszenierung einer Diva. Man soll sie bewundern und darf sie lieben, aber nur nicht zu nah. Dagmar Manzel (sie verlässt im Sommer nach achtzehn Jahren das DT) als alternde Schauspielerin Arkadina zieht die Rolle an sich, um sie im gleichen Moment fortzustoßen. Eine Studie nar zisstischer Exzentrik. Faszinierendes Maskenspiel mit lauter offenbaren Verborgenheiten. Und Schriftsteller Trigorin (Jörg Gudzuhn: sehr kunstvoll zurückgenommen) ist ein sezierender Beobachter dieser seltsamen Spezies Weib.
Die Liebe. Sie gibt es in reiner Form nur bei Mascha (ganz Selbstekel gewordener Schmerz: Ulrike Krumbiegel). Sie opfert sich für Kostja (der sie verabscheut), indem sie ihm entsagt und einen Menschen heiratet, der so trist ist wie seine traumlose Welt, an der sie zugrunde gehen wird. Alle anderen werden einander gegenseitig zur Projektionsfläche der sie treibenden Träume. Alle sind sie Untergeher, früher oder später. Die Idealisten zuerst, die zynischen Routiniers zuletzt.
Trigorin ist für Nina von Anfang an ein Teil des sie faszinierenden Kunstkosmos. Sie hat auch am Ende mit ihm keine offenen Rechnungen; ihre Enttäuschung ist die von sich selbst, ihres zu kleinen Talents. Kostja und Trigorin sind nur Randfiguren dieser Enttäuschung. Kostja hat sein Leben wie Nietzsche auf die Katastrophe hin gebaut und keine Liebe neben sich je bemerkt. Weil er immer zu sehr mit der eigenen, vagen Liebe beschäftigt ist. Als symbolistischer Jung-Dichter hat Kostja es auf seine Art gesagt und der von ihrem Traum berauschten Jung-Schauspielerin Nina eine tote Möwe vor die Füße geworfen: Siehe, das bist du, schön, aber tot, liebesunfähig, die Gesten der Liebe immer nur nachahmend! Weiß der Dich-
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.