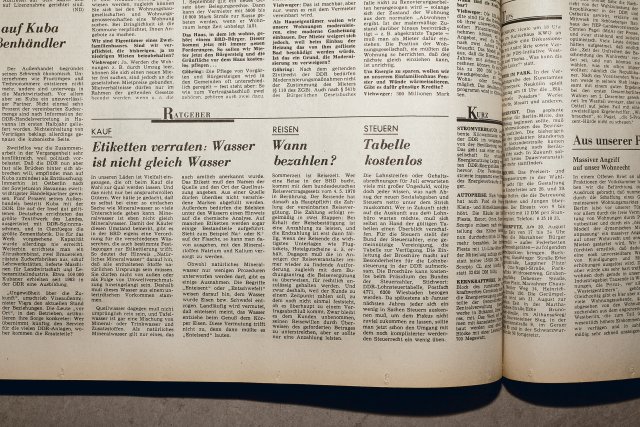Bankgeschäfte auf dem Sofa
Online-Banking
Mit dem Internet drangen die Banken erstmals direkt in unsere Wohnzimmer ein. Wir schreiben das Jahr 1983, als der damalige Postminister und Banker Christian Schwarz-Schilling (CDU) auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin den Start für die neue Technologie gab. Heute nutzt jeder zweite Bundesbürger Online-Banking. Über 45 Millionen Online-Konten werden von Banken und Sparkassen in Deutschland geführt.
Begonnen hatte alles mit dem längst verblichenen Bildschirmtext, kurz Btx: 1983 wurde das in Großbritannien entwickelte System »Viewdata« auch in der Bundesrepublik eingeführt. Im Sommer 1990 gelangte Btx auch noch in die späte Deutsche Demokratische Republik.
Anfangs wurden per Telefonleitung die Daten noch auf einen Fernsehbildschirm übertragen. Erste Anwendung für die Kunden war damals das »Postbank Online-Banking«. Damit konnten Bankkunden erstmals von Zuhause aus Überweisungsaufträge zu erteilen und Kontostände abzurufen.
In den 90er Jahren, als das Online-Geschäft wie auch das Internet immer noch in den Kinderschuhen steckten, warben die Finanzinstitute vor allem mit günstigen Preisen für das »Home-Banking«. Im Regelfall ist auch heute noch ein Online-Konto günstiger als ein klassisches Girokonto in der Filiale an der Ecke. Allerdings bieten die Deutsche-Bank-Tochter Postbank, die Sparda-Banken und andere unter bestimmten Bedingungen auch ein normales Girokonto zum Nulltarif an. Kostengünstiger ist ein Online-Konto dann vor allem für Verbraucher, die häufig Aktien und Wertpapiere kaufen, viele Überweisungen schreiben oder Geldgeschäfte regelmäßig im Ausland tätigen.
Ob nun Online-Banking »bequem« oder eine »Zumutung« ist, bleibt Ansichtssache. Im Geldalltag haben wir uns allerdings andernorts längst daran gewöhnt, klassische Bankfunktionen selber auszuführen: Beim Abheben am Geldautomaten oder wenn wir unsere Kontoauszüge in der Filiale ausdrucken. Dadurch gingen viele Arbeitsplätze von Kassierern und Sachbearbeiterinnen verloren.
Aber ist Online-Banking auch sicher? Lange Zeit behaupteten Banken und Sparkassen, ihre Systeme seien gut geschützt und für den Verbraucher gefahrlos. Trotzdem tauchten in den Medien immer wieder spektakuläre Fälle von Geldraub im Internet auf. Auch Verbraucherschützer warnten vor einfachen PIN- und TAN-Verfahren: Die Kunden erhielten von ihrem Finanzinstitut nur eine geheime Persönliche Identifikationsnummer (PIN) sowie eine Liste mit Dutzenden Transaktionsnummern (TAN). Beides musste bei Bedarf in den heimischen PC eingegeben werden - und ließ sich von Gaunern ausspähen.
Inzwischen bieten Banken, Sparkassen und Direktbanken sicherere Versionen an. Beispielsweise schickt die Bank für die Autorisierung von Aufträgen eine »mobile« TAN aufs Handy, und es wird vom Kunden zusätzlich zur PIN ein Passwort festgelegt.
Der richtige Albtraum für Kontenknacker basiert jedoch nicht auf Software, sondern auf Hardware: Eine externe Chipkarte oder ein USB-Stick werden mit dem PC verbunden. Intern führten Finanzdienstleister zudem umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durch, die gegen Angriffe bei der Übertragung von Daten über das Internet schützen oder welche den Bankenserver gegen Attacken von außen und innen abschirmen sollen.
Hermannus Pfeiffer
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.