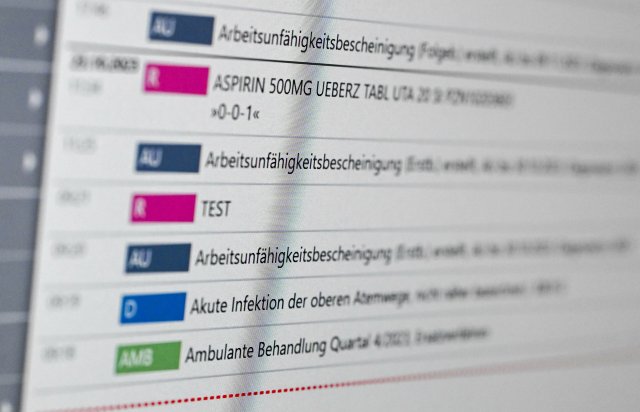Österreich als europäischer Normalfall
Walter Baier über die Gefahr einer ernsthaften politischen Krise am Beispiel der zur EU gehörenden Alpenrepublik
Es mag dem Wunsch entsprungen sein, sich für 48 Stunden der heimischen Kritik zu entziehen, der Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann veranlasst hatte, sich vorige Woche nach Athen aufzumachen, um dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras seine Sympathie zu bekunden. Man muss den guten Willen keineswegs bestreiten. Doch freundschaftliche Gesten bleiben folgenfrei, wenn in der Politik der konservative Koalitionspartner, der seinerseits ein Zusammengehen mit der rechtspopulistischen FPÖ vorbereitet, Melodie und Takt vorgibt.
Als Karl Kraus Österreich als eine »Versuchsstation des Weltuntergangs« bezeichnete, hatte er das Habsburger-Reich vor Augen, dessen Ende gültige Lehren für Europa beinhaltet. Jedenfalls meinte er nicht den Kleinstaat, der entgegen dem Vorurteil nicht im Zentrum Europas liegt, den aber die Gegner im Kalten Krieg durch Marshall-Plan und Neutralität in eine kapitalistische Musterkolonie verwandelten. Sozialdemokraten und Konservative, die ihre Feindschaft begruben, genauer gesagt durch den gemeinsamen Antikommunismus ersetzten, konnten so einen beachtlichen Sozialstaat aufbauen. Das ist in wenigen Worten zusammengefasst die Erfolgsformel, die die Zweite Republik Österreich vom sich selbst bezweifelnden Staat der Zwischenkriegszeit unterschied.
Vom Glanz der Ära Kreiskys ist heute kaum mehr als die verklärende Erinnerung zu spüren. Die Privatisierung der verstaatlichten Industrie und Banken sowie die Übernahme der im EU-Maastricht-Vertrag vorgeschriebenen monetaristischen Wirtschaftspolitik haben Österreich bezüglich Arbeitslosigkeit, Prekarisierung der Arbeitswelt und sozialen Rückbau dem europäischen Standard angenähert. Seit der Finanzkrise herrscht europäischer Normalfall. Mehr noch, die Pleite der Hypo-Alpe-Adria-Bank, verursacht durch die betrügerische Finanzpolitik der Kärntner Landesregierung unter Jörg Haider, schlägt mit einer Schadenssumme von 30 Milliarden Euro – immerhin 10 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung – zu Buche.
Sozialdemokraten und Konservative, die sich jahrzehntelang Macht und Pfründe teilten, zahlen nun die politische Zeche für die Folgen der Auslieferung des Landes an die Finanzmärkte. Den Nutzen lukriert paradoxer Weise die FPÖ, die sich nach dem Ende ihrer blamablen Regierungsbeteiligung zu Beginn der 2000er Jahre neu aufstellen konnte. Die neuesten Meinungsumfragen, veröffentlicht nach der Bildung einer SPÖ-FPÖ-Koalition im Burgenland, sehen sie als die mit einigem Abstand stärkste Partei.
Der Aufstieg des Rechtspopulismus in Österreich, alarmierend wie er ist, liegt im europäischen Trend, der sich auch in den jüngsten Wahlen in Dänemark zeigte, wo die rechte Volkspartei nun die Bedingungen für die Regierungsbildung diktiert. Im Unterschied zu anderen rechtspopulistischen Parteien Europas hat aber die FPÖ ihre Nabelschnur zum Nationalsozialismus niemals vollständig durchtrennt, auch weil sie ihrer Ideologie nach eine deutschnationale Partei ist, das heißt die Deutsch sprechenden Österreicher und Österreicherinnen nach Kultur und Blut für Deutsche – womöglich sogar die Besseren – hält.
Österreich ist heute keine Versuchsstation, sondern ein europäisches Exempel dafür, wie Wirtschaftskrise, Glaubwürdigkeitsverlust des politischen Systems und neuer Nationalismus sich zu einer gefährlichen politischen Krise verdichten. Spätestens nach den Wahlen im »rot-grünen« Wien im Oktober ist zu erwarten, dass die Krise der SPÖ und des überkommenen politischen Systems Österreichs schlagend wird.
Eine bei bundesweiten Neuwahlen drohende Regierung unter Beteiligung oder gar Führung der FPÖ würde aufgrund der über dem Land sich zusammenbrauenden Finanzkrise und auch, weil seitens der EU anders als im Jahr 2000 kein Einspruch zu erwarten ist, eine gefährliche Entwicklung einleiten. Das beginnt man auch in der fragmentierten österreichischen Linken zu verstehen, in der erstmals einflussreiche Gruppen der Sozialdemokratie und der Grünen die Gründung einer neuen linken Partei erwägen. Auch in der KPÖ beteiligt man sich an dieser Debatte. Einiges ist möglich, aber nichts ist entschieden. So ist Österreich.
Ein Argument hat dabei an Gewicht gewonnen: Wenn Österreich sich wirtschaftlich und politisch dem europäischen Normalzustand angleicht, dann muss es für die Linke höchste Zeit sein, aufzuholen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.