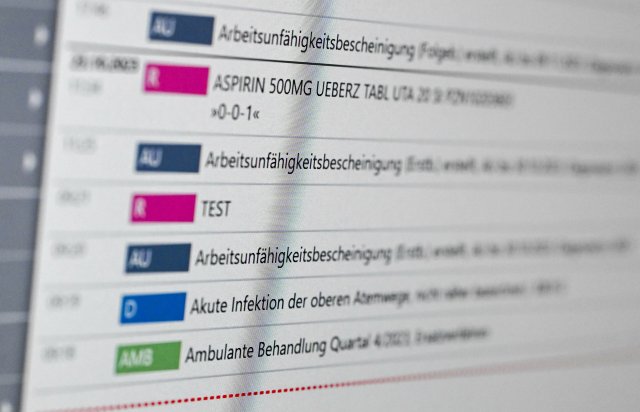Trump-Kritik
Leo Fischer findet, dass der neue US-Präsident die fleischgewordene Kapitalismuskritik ist: Der Brutalste gewinnt
Im Grunde ist die Welt jetzt wieder so eingerichtet, wie sie sich Kinder vorstellen. Der reichste Mann der Welt ist ihr Chef. Er wohnt in einem riesengroßen Haus aus Gold, telefoniert den ganzen Tag und kommt abends im Fernsehen. Er hat die schönste Frau der Welt geheiratet und passt auf, dass uns die Bösen nichts wegnehmen. Außerdem ist er mit den Chefs der ganzen anderen Länder befreundet und lacht mit ihnen. Er ist oft mit dem Hubschrauber unterwegs und bezahlt dem Papa sein Gehalt.
Letztlich ist es ein frühkapitalistisches Idyll, das die Figur Trump heraufbeschwört: eine Welt, in der die Sphäre der Vermittlung, des Verfahrens, der Bürokratie, der Diskussion, des Meinungsstreits verschwunden ist. Kein Gerede, keine Formalie stört die gemeinschaftliche Arbeit für das an sich Gute. Die Welt ist geordnet nach Kontoständen, und der Bissigste und Ehrgeizigste erhält neidlos Macht und Wohlstand.
Leo Fischer war Chef des Nachrichtenmagazins »Titanic«. In dieser Rubrik entsorgt er den liegen gelassenen Politikmüll.
Es passt, dass Trumps Übergangsteam hunderte Posten in der Exekutive noch immer nicht neu besetzt hat: Die Idee der Verwaltung ist seinem charismatischen Herrschaftsansatz per se abhold. Verwaltung bedeutet hier Verzögerung, Unbestimmtheit, Unberechenbarkeit. Wer in den ersten Wochen etwas von seinem Team wollte, musste im Trump-Tower anrufen, wurde gelegentlich sogar übergangslos zum Chef durchgestellt. Die charismatische Persönlichkeit kittet die Lücken, die Entfremdung in die Gesellschaft geschlagen hat. Schon jetzt hat Trump zahlreiche dieser Lücken offenbart - sein Instinkt, »loop-holes«, Schlupflöcher in Wirtschaft und Justiz auszunutzen, hat ihn dafür prädestiniert. In den Wochen des Übergangs stellten zahlreiche amerikanische Politjournalisten mit einer Mischung aus Überraschung und Entsetzen fest, dass die meisten Traditionen des Machtwechsels und der präsidentiellen Arbeitsweise keineswegs gesetzlich festgeschrieben sind, sondern eben nur das waren: Traditionen. Kein Paragraf sagt, dass der Präsident nicht nebenbei noch ein Milliardenunternehmen führen darf; Trumps Zugeständnisse in dieser Sache waren demgemäß nur formaler Art. Was sich hehr »demokratische Kultur« nennt, was in Verfahren und Verbindlichkeiten gegossen schien, zeigt sich jetzt, dank Trump, als Bestimmung reiner Willkür: Eine Kultur kann Gesetze nicht ersetzen.
Auch in der Fantasie der Europäer, der Deutschen wird Trump zum Abziehbild seiner selbst. Einerseits ist er das, was einmal als der »Onkel aus Amerika« durch die Witzbücher geisterte: Bei ihm ist alles riesengroß, er hat das dickste Auto, die größte Zigarre und in jedem Zimmer einen Swimmingpool. Da bleibt dem Neffen in Europa nur neidvolles Staunen. Zugleich wallt ein völlig gegenteiliger, nachgerade pädagogischer Gestus durch die Kommentarspalten: Der Amerikaner ist hier wieder der leichtsinnige Jugendliche, der Schulhof-Rowdy, der beizeiten aus dem alten, weisen Europa belehrt werden muss. Mal hoffen die Leitartikel, das System Washington oder die republikanische Partei würden Trump bald zügeln - und verkennen, dass Trump keinerlei Abhängigkeiten in diese Richtungen unterhält, sich bei niemandem politischen Kredit geholt hat. Er hat Partei und Apparat einfach überrollt - warum sollte er jetzt vor ihnen kuschen? Andere glauben, die außen- und wirtschaftspolitischen Abhängigkeiten der USA würden den Präsidenten schon noch einholen - als wären dies Kriterien, an denen Trump Erfolg misst. Im Zweifel wird es ihm immer um die »ratings«, die Einschaltquoten, die Beliebtheit im eigenen Land gehen. Die Welt ist ein Nebenkriegsschauplatz.
Auf gewisse Weise kann man ihm dankbar sein: Mit Trump verschwinden all die Vermittlungsorgane, Politik, Staat und Verwaltung, die im Kapitalismus das Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten zu verschleiern bestimmt sind. Die Milliardäre sind jetzt direkt am Ruder, müssen sich nicht mehr hinter Repräsentanten und Parteien verstecken. Gleichzeitig spricht sein Sieg eine Wahrheit aus, die furchtbarer und ernüchternder nicht sein könnte: Der Brutalste und Gemeinste gelangt in dieser Lebensform immer an die Spitze; er muss weder nett noch schön noch schlau sein. Dass diese Wahrheiten jetzt so offenkundig auf der Hand liegen, auf keine Weise mehr beschönigt werden können, das immerhin hat Trump schon jetzt geschafft. Er ist fleischgewordene Systemkritik, Vertreter des Systems und zugleich Verhöhnung dieses Systems. Er übernimmt den Job seiner Kritiker gleich mit. Dafür schon mal danke, Trump!
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.