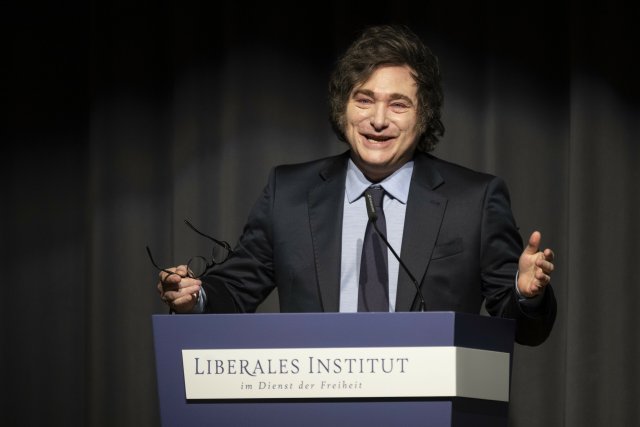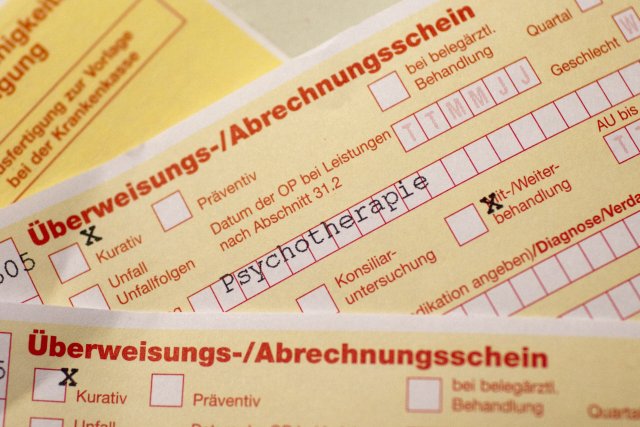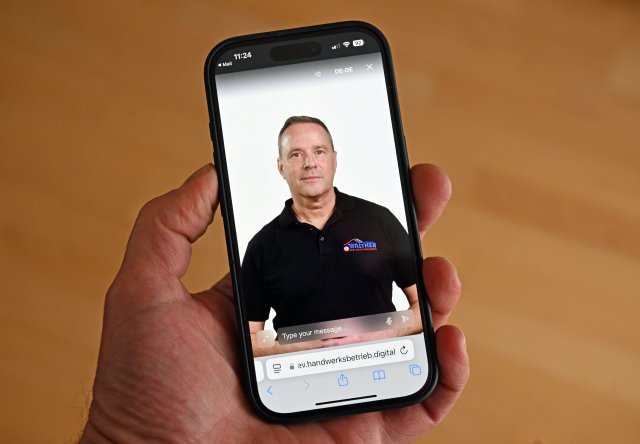Smart City auf Sand gebaut
Microsoft-Chef will eine »intelligente Stadt« der Zukunft in der Wüste Arizonas bauen
Bill Gates geht in die Wüste. 80 Kilometer westlich von Phoenix in Arizona soll in der Sonora-Wüste Belmont entstehen, die Stadt der Zukunft. »Belmont wird ein unbebautes Stück Land in eine geplante Stadt auf dem neuesten Stand verwandeln, die rund um ein flexibles Infrastrukturmodell errichtet wird«, teilte Belmont Properties mit.
Die Firma gehört Bill Gates, dem Gründer von Microsoft, dem ebenso Cascade Investment gehört. Dieses Unternehmen hat im Auftrag des zweitreichsten Mannes der Welt - nach Jeff Bezos von Amazon - soeben für 80 Millionen Dollar (umgerechnet 68,64 Millionen Euro) das Gelände im Westen von Phoenix gekauft, insgesamt 10 000 Hektar.
Den Namen Belmont für die Stadt der Zukunft soll Bill Gates selber ausgesucht haben. Die Stadt soll 80 000 Wohnungen und Häuser beherbergen, aber auch eine Wirtschaftszone, Büros und Ladengeschäfte, öffentliche Schulen und viele Grünflächen. Derzeit ist es noch ein Stück unwirtliches Land im Nirgendwo, allerdings nur sieben Kilometer von der geplanten Autobahn von Mexiko über Phoenix nach Las Vegas entfernt.
Die Stadtplaner in den USA hoffen, dass Belmont eine neue Vision des Bauens im Südwesten der USA mit sich bringen wird. Dort hat ungezügelte Bautätigkeit zu Staus und Smog in einer Region geführt, die in früheren Jahren zum Magneten für Rentner und andere geworden war, die saubere Luft und ein ruhiges Leben suchten. »Sie denken neu darüber nach, wie eine Stadt aussehen soll, deren Entwicklung nicht von Bauinteressen bestimmt wird«, sagt Grady Gammage, Immobilienanwalt bei Belmont Properties.
Nutzung von Sonnenenergie, autonom fahrende Autos und andere moderne Technologien werden der Schlüssel zur Verwirklichung der Vision sein. »Belmont wird eine vorausschauende Stadt schaffen, mit einem Rückgrat von Kommunikation und Infrastruktur, mit Technologie auf dem neuesten Stand, digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen, Datenzentren, neuen Produktionstechniken und neuen Versorgungsmodellen, autonomen Fahrzeugen und autonomen Logistikeinrichtungen«, versichert Belmont Properties. Neben Arizona finanziert Microsoft derzeit in Columbus im Bundesstaat Ohio die Entwicklung eines intelligenten Verkehrsleitsystems. Autonom fahrende Shuttles sollen dort das Fehlen eines Busnetzes in der 860 000 Einwohner zählenden Stadt ausgleichen.
In Arizona freut man sich über das neue Projekt. Man erwartet, dass dadurch Jungunternehmen und andere Firmen entstehen werden, die neues Wachstum in diesem Bundesstaat generieren. »Bill Gates ist für seine Innovationen bekannt und ich glaube, er hat den richtigen Platz ausgewählt«, sagt Ron Schott, ehemals Leiter des Technologierates von Arizona. »Schließlich ist Arizona als ein Platz für Innovationen bekannt.«
Aber es wurden auch Fragen zu dem Vorhaben laut. So warnt Jon Talton, Kolumnist der »Seattle Times«, der selber aus Arizona stammt, vor den Herausforderungen durch das Klima. Viele Utopien, die für Arizona entwickelt worden seien und zu Baubooms und einem Auf und ab im vergangenen Jahrhundert geführt hätten, seien an einem Problem gescheitert: Wasser.
»Arizona hat nicht genug Wasser, um diese Art Entwicklungen weiterzumachen, was immer auch die Großsprecher der Immobilienfirmen erzählen«, schreibt Talton. »Es ist sogar eine offene Frage, ob Phoenix Mitte des Jahrhunderts noch bewohnbar sein wird«, fügt er mit Blick auf die Hauptstadt des Bundesstaates mit ihren 1,6 Millionen Einwohnern hinzu.
Mit seinem Projekt steht der Microsoft-Chef derzeit nicht alleine da. Zuletzt hatte der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman angekündigt, für mehr als 500 Milliarden US-Dollar (rund 425 Milliarden Euro) eine futuristische Megastadt am Roten Meer bauen zu wollen.
Die Idee der sogenannten »intelligenten Stadt« ist nicht neu. In den 70er Jahren baute der italienische Architekturprofessor Paolo Soleri die futuristische Stadt Arcosanti, ebenfalls in Arizona und in damals modernster Architektur. Die Investitionsruine zieht zwar jährlich tausende Besucher an, aber keine Einwohner.
Die zunehmende Durchoptimierung moderner Städte birgt jedoch auch massive Risiken und Nebenwirkungen. Zudem stecke nicht nur technologischer Altruismus hinter den millionenschweren Investitionen, sondern zumeist auch wirtschaftliche Interessen der Unternehmen, monieren Kritiker. Als Paradebeispiel dürfte die von Henry Ford 1928 gegründete Stadt »Fordlândia« südlich der brasilianischen Stadt Santarém dienen. Ursprünglich zur billigen Reifenproduktion gedacht, wurde die Planstadt zum finanziellen Desaster. Geografische Unwissenheit, kulturelle Ignoranz und Missmanagement führten dazu, dass Ford rund 25 Millionen US-Dollar in dem Projekt versenkte und schließlich 1945 die Zahlungen einstellte, woraufhin die Stadt verwaiste.
Fachleute stoßen sich jedoch auch an der Frage, ob Städte überhaupt »smart« sein können. So schrieb beispielsweise der deutsche Architekt Albert Speer junior bereits 1992: »Nur die Menschen, die darin wohnen, arbeiten, handeln, die sie regieren oder verwalten, können durch ihr intelligentes Verhalten einer Stadt als sozialem, politischem und räumlichem Gebilde ›Intelligenz‹ verleihen.«
Zwar könnten städtische Räume durchaus effizienter und nachhaltiger gestaltet werden, wie es am Beispiel zahlreicher Science-Fiction-Filme gezeigt wird, allerdings liegen nicht selten Utopie und Dystopie extrem nah beieinander. So befürchtet der US-Soziologe Richard Sennet, dass jene Dinge, die Spontanität und Urbanität internationaler Großstädte wie Berlin ausmachten, verloren gehen könnten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.