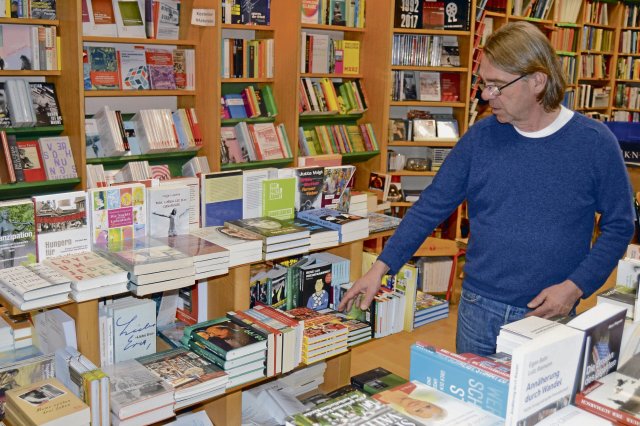- Berlin
- Chris Gueffroy
Das letzte Opfer des Schießbefehls
Mit einer Andacht wurde an den 30. Todestag von Chris Gueffroy erinnert

»Hinter jedem Opfer der Berliner Mauer steht der individuelle Name und die Biografie eines von Gott geliebten Menschen«, sagte sagte Rainer Just, ehemaliger Öffentlichkeitsreferent der Evangelischen Versöhnungsgemeinde in seiner Ansprache zum 30. Todestag von Chris Gueffroy. Mit einer Gedenkandacht in der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße hat die Stiftung Berliner Mauer am Dienstag an den 30. Todestag des von DDR-Grenzsoldaten Ermordeten erinnert.
Gueffroy stehe stellvertretend für Hunderte Todesopfer des Regimes an der innerdeutschen Grenze, so Just. Dass es 28 Jahre gedauert habe, bis die Mauer in Berlin durch die Friedliche Revolution im November 1989 zu Fall gebracht werden konnte, sei für Deutschland und Europa ein »großes Unheil« gewesen.
Nach dem Vaterunser entzündete Just eine Kerze im Gedenken an Gueffroy und die 140 weiteren Menschen, die an der Berliner Mauer zwischen 1961 und 1989 ums Leben gekommen waren.
Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, sagte am Rande der Veranstaltung, dass die Opfer auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer niemals in Vergessenheit geraten dürften. »Ihre Schicksale zeigen, wie groß der Leidensdruck und wie stark ihr Wunsch nach Freiheit gewesen sein muss«, so Klausmeier. Wenn man heute weltweit wieder über die militärische Sicherung von Landesgrenzen nachdenke, solle man an das Schicksal der Berliner Maueropfer denken. »Mauern können Menschen umbringen, sie halten sie aber nicht auf«, sagte der Stiftungsdirektor.
Chris Gueffroy wurde in der Nacht des 5. Februar 1989 in Treptow von DDR-Grenzsoldaten erschossen, als er gemeinsam mit seinem Freund Christian Gaudian versucht hatte, über die Mauer nach West-Berlin zu fliehen. Da der schwedische Ministerpräsident zu dieser Zeit in Ost-Berlin zu Gast war, hatten die beiden Freunde angenommen, die Grenzsoldaten würden nicht auf Flüchtende schießen. Für den damals 20-jährigen Gueffroy endete diese Fehleinschätzung tödlich. Christian Gaudian überlebte den Fluchtversuch schwer verletzt und wurde später zu einer Haftstrafe verurteilt.
Im Gedenkbuch für die Opfer der Berliner Mauer, das in der Kapelle der Versöhnung ausliegt, schreiben die Historiker Udo Baron und Hans-Hermann Hertle, dass der Anlass für Gueffroys Fluchtversuch die bevorstehende Einziehung in den Wehrdienst der Nationalen Volksarmee gewesen war. Gueffroy habe sich überdies in der SED-Diktatur unterdrückt und reglementiert gefühlt. Zudem habe er die Korruption in der DDR-Gastronomie verabscheut, wie die Historiker schreiben. Der 1968 in Pasewalk geborene Gueffroy hatte eigentlich professioneller Turner werden wollen. Nach dem die Behörden ihm den Zugang zum Abitur verweigert hatten, arbeitete er als Kellner in Ost-Berlin.
Gueffroy war das letzte Opfer des Schusswaffengebrauchs an der Mauer, der erst im April 1989 von Erich Honecker ausgesetzt wurde. Nach dem Fall der Mauer kämpfte seine Mutter, Karin Gueffroy, um die strafrechtliche Aufarbeitung und Ahndung der Todesschüsse auf ihren Sohn.
Am 27. Mai 1991 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier unmittelbar an der Ermordung beteiligte Grenzsoldaten. Der Prozess war einer der ersten Mauerschützenprozesse vor dem Landgericht Berlin. Während drei der Angeklagten frei gesprochen wurden, wurde einer der Todesschützen nach erfolgreich eingelegter Revision zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.
Im Gedenken an die Todesopfer der Berliner Mauer sollen ab März wöchentlich Andachten in der Kapelle der Versöhnung stattfinden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.