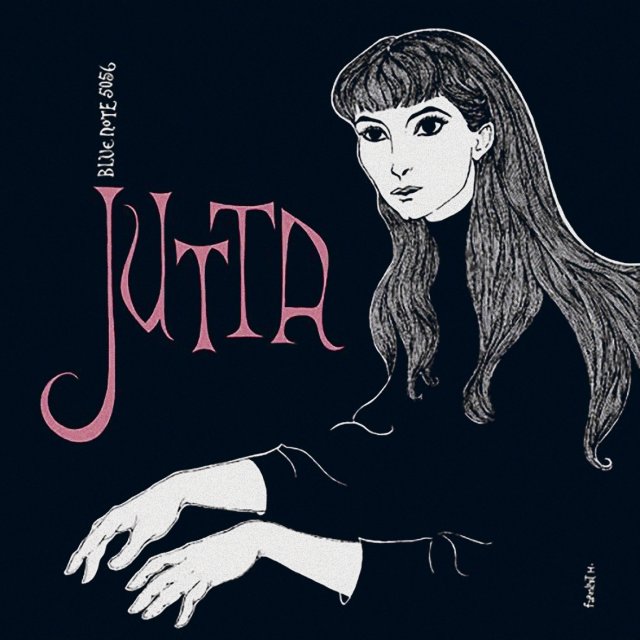- Kultur
- Netflix-Serie »Trotzki«
Verleumdung
Trotzkis Enkel protestiert gegen Serie
Seit Dezember läuft auf Netflix die russische Miniserie »Trotzki« über den russischen Revolutionär Leo Trotzki, dem Gegenspieler von Josef Stalin, der ihn 1940 im mexikanischen Exil ermorden ließ. Die acht Folgen der Serie von Alexander Kott und Konstantin Statsky waren schon 2017, im Jubiläumsjahr der Oktoberrevolution, im ersten Programm des russischen Fernsehens ausgestrahlt worden. Nun hat Esteban Volkov, der Enkel von Trotzki (Jahrgang 1926), gegen die Serie protestiert - zusammen mit mehreren bekannten Wissenschaftlern, Autoren und Intellektuellen wie Frederic Jameson, Nancy Fraser, Slavoj Zizek, Mike Davis, Michael Löwy, Eric Toussaint, Alex Callinicos und anderen.
In einer gemeinsamen Erklärung werfen sie Netflix als auch dem russischen Staat vor, Unwahrheiten über Trotzki, die Oktoberrevolution und den Frieden von Brest-Litowsk zu verbreiten. In der Serie erscheine die Oktoberrevolution als »lächerlicher, gewalttätiger Kampf«, geführt von »psychopathischen Manipulatoren«. Entsprechend würden die politischen Auseinandersetzungen unter den Bolschewiki als ein »Kampf der Egos« abgehandelt, von den Moskauer Prozessen sei keine Rede, geschweige denn vom großen Terror des Stalinismus.
Die Produzenten der Serie würden die historischen Fälschungen und Verleumdungen, denen Trotzki durch »die Imperialisten, den Zarismus und den Stalinismus« ausgesetzt gewesen war, als »wahre Fakten« betrachten. Während sein Mörder, der GPU-Agent Ramón Mercader, als sensible, ehrliche Person erscheine, werde Trotzki als messianischer und autoritärer »Egozentriker, Menschenfeind, Krimineller und Karrierist« geschildert, der aber im russischen Bürgerkrieg als eine Art »Rockstar, Sexsymbol und Mörder« ausgestellt werde. Kurzum: Der Trotzki in dieser Serie sei ein »Monstrum« und damit eine ungebrochene Fortschreibung des Klischees seiner einstigen Verfolger.
Im Gegensatz dazu würden sowohl Trotzkis erste Ehefrau Alexandra Sokolowskaja als auch seine zweite, Natalja Sedowa, als unwichtige »Hausfrauen« vorgeführt. Dabei habe der 16-jährige Trotzki in einem Lesezirkel, den Sokolowskaja leitete, seine ersten marxistischen Lektüren erfahren. Sedowa arbeitete im sowjetischen Bildungswesen und starb erst 1962 in Frankreich, während Sokolowskaja in den Säuberungen 1938 zu Tode kam. nd
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.