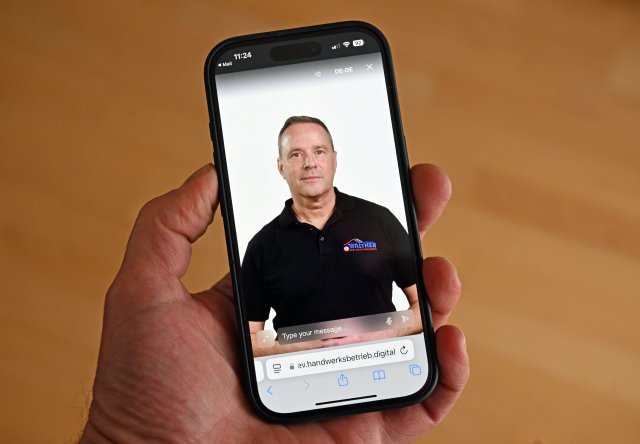- Wirtschaft und Umwelt
- Pflegenotstand
Caritas erledigt Drecksarbeit
Trotz des Pflegenotstands ist der Versuch gescheitert, die Mindestlöhne in der Branche zu erhöhen. Was bedeutet das für Beschäftigte?
Wenn Arbeitskräfte knapp sind, können sie höhere Gehälter durchsetzen, heißt es oft. Pflegekräfte sind knapp. Ihre Arbeit ist wichtig und in der Pandemie schwieriger geworden. Dennoch ist am Donnerstag der Versuch gescheitert, einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege umzusetzen, der wenigstens die Mindestlöhne erhöht hätte. Gestoppt haben das Vorhaben die Arbeitgebervertreter der Caritas. Sie haben die »Drecksarbeit« für andere gemacht, sagt der Sozialforscher Stefan Sell.
Die Gehälter in der Altenpflege sind in den vergangenen Jahren etwas stärker gestiegen als in anderen Branchen. Allerdings ist das Lohnniveau weiterhin sehr niedrig. Alte Menschen zu pflegen, wird deutlich geringer vergütet als beispielsweise chemische Erzeugnisse herzustellen. Pflegefachkräfte in Altersheimen erhielten laut Statistischem Bundesamt 2019 für einen Vollzeitjob rund 3100 Euro im Monat und damit 25 Prozent weniger als Chemie-Fachkräfte.
Helferinnen und Helfer, die oft die Pflege der alten Menschen übernehmen, erhielten im Mittel nur knapp 2150 Euro brutto, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In Ostdeutschland lag die Vergütung sogar unter 2000 Euro. Die meisten der 1,2 Millionen Angestellten in der Altenpflege verdienen noch weniger, weil sie eine Teilzeitstelle haben.
Nun war geplant, wenigstens die Mindestlöhne anzuheben. Die Gewerkschaft Verdi und einer der kleineren Arbeitgeberverbände, die BVAP, vereinbarten einen Tarifvertrag, den Arbeitsminister Hubertus Heil für allgemeinverbindlich erklären wollte. Danach war beispielsweise vorgesehen, dass Pflegekräfte mit einer einjährigen Ausbildung ab August mindestens 13,10 Euro pro Stunde erhalten müssen, das sind bei einem Vollzeitjob etwa 2220 Euro im Monat.
Laut Gesetz kann der Arbeitsminister einen Tarifvertrag in der Altenpflege aber nur dann für allgemeinverbindlich erklären, wenn Caritas und Diakonie zustimmen, wo viele Pflegekräfte angestellt sind. Am Donnerstag hat sich nun die Arbeitgeberseite der arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas dagegen ausgesprochen und damit das Vorhaben gestoppt. Die Diakonie-Kommission entschied deshalb am Freitag, gar nicht mehr darüber abzustimmen.
Nun bleibt es bei den bereits bestehenden Mindestlöhnen für die Branche. Demnach haben Pflegekräfte in Ostdeutschland derzeit Anspruch auf 11,20 Euro pro Stunde, das sind bei einer vollen Stelle weniger als 2000 Euro. Im Westen ist der Stundenlohn 40 Cent höher. Ab Juli gibt es erstmals einen Mindestlohn speziell für Fachkräfte in Höhe von 15 Euro pro Stunde. »Das ist ein Schlag ins Gesicht der Pflegekräfte«, urteilt Stefan Sell, Arbeitsmarkt- und Sozialforscher der Hochschule Koblenz. »Es ist ungeheuerlich, bei den steigenden Anforderungen selbst qualifizierte Fachkräfte mit einer dreijährigen Ausbildung mit 15 Euro brutto in der Stunde abzuspeisen.« Auch die Vergütungen, die der neue Tarifvertrag vorsah, wären zu niedrig gewesen, sagt Sell. Schließlich werde in anderen Branchen für Facharbeit mehr als 20 Euro pro Stunde bezahlt.
Beschäftigte, die in Privathaushalten leben und sich um alte Menschen kümmern, haben noch weniger Rechte. Oft sind dies Frauen aus Polen oder Rumänien. Die meisten haben nicht einmal Anspruch auf den Pflegemindestlohn, erläutert Justyna Oblacewicz, Referentin der Organisation Faire Mobilität, die Beschäftigte aus Osteuropa berät. Denn viele werden in den Verträgen als Haushaltshilfen bezeichnet, andere gelten offiziell als selbstständig. Wenn sie bei dem Privathaushalt direkt angestellt sind, haben sie laut Arbeitsministerium generell keinen Anspruch auf den Pflegemindestlohn, sondern nur auf den gesetzlichen Mindestlohn, der auch noch schwer durchzusetzen ist. Es handelt sich hier um viele Beschäftigte, die viel leisten für wenig Geld. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland bis zu 600 000 sogenannte 24-Stunden-Betreuungskräfte, die zumeist aus Osteuropa kommen, so Oblacewicz.
Die Arbeit von Pflegekräften in Heimen und Privathaushalten ist anstrengend, und sie ist in der Pandemie belastender geworden. »Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter einem enormen psychischen Druck«, sagt Rolf Cleophas, Sprecher der Mitarbeiterseite der arbeitsrechtlichen Kommission bei der Caritas. »Sie haben Angst, sich zu infizieren, das Virus in die Einrichtung zu tragen, und sie haben Angst um ihre Familien.« Er kenne zig Fälle von Arbeitsquarantäne, bei der die Beschäftigten weiter ihren Job machen, obwohl sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Sie dürfen dann nur zur Arbeit und müssen ansonsten zu Hause bleiben.
Die Caritas-Mitarbeitervertreter zeigten sich denn auch enttäuscht über die Ablehnung der Arbeitgeberseite. »Ein allgemeinverbindlicher Tarif Altenpflege hätte für Tausende zumeist bei privaten Anbietern beschäftigen Menschen ein Ende von Dumpinglöhnen bedeutet«, heißt es in einer Pressemitteilung.
Laut Cleophas liegen die Caritas-Gehälter derzeit über den Mindestvergütungen, die der geplante Branchen-Tarifvertrag vorsah, auch in kommunalen Einrichtungen erhalten Pflegehelferinnen mehr. Für die Caritas hätte sich also zunächst nichts geändert. Warum haben die Arbeitgeber dann Nein gesagt? Der Dienstgeber-Vertreter der Caritas, Norbert Altmann, hatte bereits vor der Abstimmung erklärt, es drohten Konflikte im Gefüge der Caritas-Gehaltsregeln. So sollten laut Tarifvertrag ungelernte Beschäftigte in der Altenpflege ab Juni 2023 mindestens 14,40 Euro erhalten. »Das würde die Frage aufwerfen, warum das nicht auch für Hilfskräfte in anderen Bereichen gelten soll«, sagte Altmann der »FAZ«. Auf längere Sicht fürchtete er also schon, dass auch bei der Caritas der Druck gestiegen wäre, Löhne zu erhöhen.
Damit verbunden ist eine generelle Befürchtung: Manche hätten den sogenannten Dritten Weg in Gefahr gesehen, wenn der Tarifvertrag allgemeinverbindlich erklärt wird, so die Caritas-Arbeitgeber. Der »Dritte Weg« bezeichnet die Art, wie in vielen kirchlichen Einrichtungen die Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden, nämlich von internen, arbeitsrechtlichen Kommissionen, in denen Mitarbeitende und Arbeitgebervertreter sitzen. Dieser Weg basiert auf Sonderregelungen für Kirchen, die sich aus ihrem Selbstbestimmungsrecht ableiten. Dazu gehört auch, dass das Streikrecht eingeschränkt ist.
»Die strategischen Befürchtungen gehen offenbar dahin«, so Sell, »dass der Tarifvertrag später die heute noch besseren Regelwerke der Kirchen überholen könnte und darüber das Sonderrecht der Kirchen ausgehöhlt wird. Das Schlimme ist: Die Caritas macht die Drecksarbeit für private Arbeitgeber, die oft extrem niedrige Gehälter zahlen und jede Tarifbindung meiden wollen wie der Teufel das Weihwasser.«
Hinter alldem steht ein Problem, das oft beklagt und dennoch ungelöst ist: Es gibt zu wenige öffentliche Mittel für die Altenpflege. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen kritisiert schon länger die hohen Eigenanteile der Pflegebedürftigen. Im Schnitt müssten Heimbewohner derzeit 2068 Euro im Monat aus der eigenen Tasche dazu zahlen, so ein Sprecher des Spitzenverbands. »Die Eigenanteile haben eine Höhe erreicht, die sozialpolitisch nicht mehr zu verantworten ist.«
Gesundheitsminister Jens Spahn plant eine Begrenzung des Eigenanteils und einen Bundeszuschuss an die Pflegeversicherung. Zu viel sollte man sich davon nicht versprechen. Denn der CDU-Politiker setzt bei der Finanzierung der Altenpflege auch auf die private Vorsorge.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.