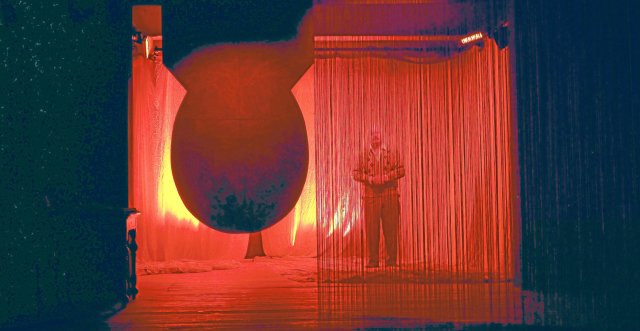- Berlin
- Solidarisches Grundeinkommen
Katschs Neuanfang
Das Berliner Solidarische Grundeinkommen hilft Menschen, beruflich wieder Anschluss zu finden

Glück und Pech fielen zusammen, als sein Arbeitsalltag zur Strapaze wurde. Mario Katsch hatte eine Stelle in einer Berliner Firma für Facility-Management. «Im Grunde erledigte ich drei Jobs in einem, das war übel», erzählt Katsch in ruhigem Ton und rückt seine schwarz umrandete Brille zurecht. Neben der Hausmeistertätigkeit musste er die Reinigung der Hausflure, Winterdienste und Gartenarbeiten übernehmen. Doch dann wurde er Vater. 2017 war das - Katsch gerade 30 Jahre alt. «Ich wollte meinen Sohn aufwachsen sehen, Zeit mit ihm verbringen, nicht spätabends abgekämpft von der Arbeit kommen», resümiert er mit einer Entschiedenheit, als liege diese Zeit vor ihm. «Der Zufall wollte es, dass meine Firma Aufträge verlor und mir kündigte. So hatte ich Anspruch darauf, ein Jahr lang Arbeitslosengeld zu beziehen. Und ich hatte Zeit, mich um meinen Sohn zu kümmern.»
Schnell war das Jahr herum. Die Beziehung zur Mutter seines Sohnes zerbrach, und Katsch sollte aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. «Als Arbeitsloser eine Wohnung zu finden, ist fast aussichtslos», sagt der Berliner. «Wir schliefen bei Freunden auf der Couch, was schon wegen meines Sohnes keine Dauerlösung sein konnte.» Schließlich zog Katsch wieder zu seiner Mutter, die eine Vierzimmerwohnung hat. Katsch wollte wieder arbeiten, bekam jedoch unzählige Absagen - meist deshalb, weil er keinen Führerschein besitzt. Zudem gestaltete sich das Verhältnis zu seiner Arbeitsvermittlerin im Jobcenter schwierig. «Die wollte mir immer Ein-Euro-Jobs reinknallen», erzählt Katsch und rollt dabei mit seinen blauen Augen. «Ihre Vorstellung war, dass ich sie annehmen müsse, wenn ich Unterstützung bekommen wollte. Ich habe ihr klar gesagt, dass ich diese Jobs nicht haben will.» Katsch blieb standhaft und beschwerte sich auf übergeordneter Ebene. Eine richtige Entscheidung, wie sich herausstellte: Er bekam eine neue Arbeitsvermittlerin zugeteilt, die ihm das Solidarische Grundeinkommen (SGE) und eine Stelle als Quartiersläufer bei der Berlinwohnen Hausmeister GmbH anbot, einer Tochterfirma des städtischen Wohnungsunternehmens Gesobau.
Mit dem 2019 gestarteten SGE hat das Land Berlin ein bundesweit einzigartiges Beschäftigungsprojekt geschaffen. 1000 vormals arbeitslose Berlinerinnen und Berliner haben seitdem innerhalb des Pilotprojektes eine gemeinwohlorientierte Beschäftigung in elf unterschiedlichen Einsatzbereichen aufgenommen. Die Tätigkeiten erfüllen die Kriterien der Guten Arbeit und werden für fünf Jahre gefördert. Wenn im Anschluss kein Übergang in reguläre Beschäftigung gelingt, garantiert das Land Berlin eine Weiterbeschäftigung. Bezahlt wird nach Tarifvertrag, wenn der beschäftigende Betrieb tarifgebunden ist. Ist das nicht der Fall, wird nach Mindestlohn bezahlt. Maßgeblich dafür ist der Berliner Landesmindestlohn, der aktuell bei 12,50 Euro je Stunde liegt.
Mario Katsch erzählt gerne seine Lebensgeschichte. Noch nie habe er sie jemanden so ausführlich erzählt, sagt er. Vielleicht rutscht er deshalb etwas aufgeregt auf seinem Stuhl hin und her. Und vor allem: Noch nie habe sich jemand so dafür interessiert, schiebt er nach und lacht, sodass seine markanten Augenbrauen hüpfen. Er könne «ganze Romane» erzählen, so viel habe er erlebt. Das Solidarische Grundeinkommen ist ein neues Kapitel. «Ende Oktober 2020 hatte ich mein Vorstellungsgespräch - die SGE-Stelle trat ich gleich im November an», sagt Katsch.
Quartiersläufer unterstützen hauptamtliche Hausmeister von Wohnungsbaugesellschaften. Derzeit ist Katsch in Pankow eingesetzt, hauptsächlich in Altbauten. Seine zentrale Aufgabe ist es, den Zustand der Wohnanlagen zu kontrollieren. Er ist bei Wohnungsübergaben mit dabei, hilft bei der Koordination von Gewerken, beim Wechseln von Türschlössern und bei der Organisation der Sperrmüllentsorgung. «Ich kommuniziere mit den Mieterinnen und Mietern, nehme Anrufe entgegen und schaffe bei den einfacheren Problemen selbst Abhilfe. Älteren Herrschaften trage ich den Einkauf hoch in die Wohnung.» Dass er mitunter den Ärger von Mieterinnen und Mietern abbekommt, nimmt er mit Humor. «Als sich ein älterer Herr mokierte, die Gesobau sei unmöglich, und in der DDR sei alles besser gewesen, war ich baff. Eine halbe Stunde nach seinem Anruf stand ich bereits in seiner Wohnung, um zu helfen - ich glaube nicht, dass das zu DDR-Zeiten Standard gewesen ist.»
Beruflich hatte es Katsch eigentlich an den Herd gezogen. Nach dem Realschulabschluss 2003 begann er eine Lehre als Koch im Evangelischen Johannesstift in Spandau. «Die Ausbildung war extrem arbeitsintensiv. Wir kochten nicht nur à la carte, sondern in einer eigenen Großküche auch für Krankenhäuser und Kitas.» Als der Flughafenbetrieb in Tegel sukzessive abgebaut wurde, lieferte die Küche zusätzlich Essen an die Lufthansa und Continental Airlines. «Damit wuchs das Arbeitspensum noch mehr.»
Katsch stand die Lehre durch und bewarb sich anschließend als Koch bei der Bundeswehr. Er lernte, in einer Feldküche zu arbeiten. Wegen einer schweren Knieverletzung musste er jedoch einige Zeit aussetzen. «Dadurch war ich nicht dabei, als es einen Monat in den Wald ging, wo ich hätte kochen sollen», sagt er. Seinem Oberfeldwebel gefiel sein krankheitsbedingter Ausfall nicht, sodass er Katschs Vertragsverlängerung nicht absegnete. «Als er es sich kurz vor Auslaufen des Vertrages doch noch anders überlegte, war ich zu stolz, um zu bleiben.»
In der Folgezeit ackerte Katsch in verschiedenen Restaurantküchen. Mal kochte er für «Touris», mal für «Stammis», wie er die Restaurants nach ihren Gästen einteilt. «In Touri-Küchen lässt die Hygiene oft zu wünschen übrig», sagt er. «Es kam wiederholt vor, dass ich wochenlang geputzt habe, bis ich reinen Gewissens kochen konnte.»
Wenn Katsch heute über sein Leben als Restaurantkoch spricht, fällt ihm nur das Wort «Sklavenarbeit» ein. «Die Bedingungen in dem Job waren unterirdisch. Es war normal, zehn Tage durchzuarbeiten - mit Arbeitszeiten von zwölf bis vierzehn Stunden», erzählt er. «Ich habe immer versucht, die Situation, in die ich gestellt werde, zu meistern, aber irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich hatte die Nase gestrichen voll und begann, nach anderen Jobs zu suchen.»
Zuerst probierte er es als Verkäufer für Handyverträge. «Das war gut bezahlt, und ich musste weniger Stunden als in der Küche arbeiten», sagt Katsch. «Aber ich war nicht gut darin.» Menschen Knebelverträge aufzuschwatzen und sie über den Tisch zu ziehen, ging ihm gegen den Strich. Er unterschrieb lieber bei einem Sicherheitsdienst, der ihn als Objektschützer, Ladendetektiv und Rausschmeißer einsetzte. Das dürftige Gehalt besserte Katsch mit Gelegenheitsjobs auf dem Bau auf. Während dieser Zeit wohnte er in WG-Zimmern, weil er sich keine Wohnung leisten konnte. Zwischendurch kam er bei Freundinnen oder bei seiner Mutter unter. Bis er von einem Bekannten die Stelle in der Firma für Facility-Management vermittelt bekam - und wenig später Vater wurde.
Das unstete Leben begann für Mario Katsch, als ihm selbst noch jedes Bewusstsein dafür fehlte. Er war ein Kleinkind, als seine Mutter wenige Monate vor der Wende mit ihm aus Ostberlin nach Westdeutschland flüchtete. Sie strandeten im nordrhein-westfälischen Solingen. Katschs Vater, ein Maurer und Fliesenleger, kam nach, als kurze Zeit später die Mauer fiel. Ein paar Jahre lebte die Familie in Solingen, bis die Eltern mit Mario und seinem inzwischen geborenen Bruder ins brandenburgische Zeuthen zu den Großeltern zogen. Doch das Familienleben gestaltete sich schwierig. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion trennte sich die Mutter vom Vater und floh mit den Kindern erneut. Als Erstes landeten sie in einem Asylheim. Arbeitslos und ohne eigene Wohnung fand die Mutter irgendwann Platz in einem Frauenhaus.
Im Kindergartenalter attestierte man Katsch eine Lernbehinderung, weil er zu schnell und unverständlich sprach. Für die ersten zwei Schuljahre besuchte er deswegen eine Förderschule. Als er besser sprechen konnte, wechselte er auf eine Grundschule in Lichtenberg, wo er die zweite Klasse wiederholen musste. Später wies ihm das Bezirksamt die weiterführende Oberschule am Rathaus Lichtenberg zu, damals noch eine Hauptschule. Als Modellprojekt gab es jedoch eine Realschulklasse, in der höhere Anforderungen einen vollgültigen Realschulabschluss ermöglichten. «Die Prüfungen bestand ich relativ gut», sagt er.
Katsch weiß, was er kann - wenn die Bedingungen stimmen. «Die Gesobau ist ein toller Arbeitgeber. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, bekomme ich sofort Hilfe. Voll des Lobes spricht er auch über das Coaching, das die SGE-Stelle begleitet und den Übergang in den regulären Arbeitsmarkt vorbereiten helfen soll. »Meine Coachin unterstützt mich aktiv und vielfältig. Manchmal gibt sie mir sogar Erziehungstipps!«, sagt er. Vor allem bemühe sie sich, gemeinsam mit Katsch auszuloten, wo seine Zukunftsperspektiven liegen. Begleitend zum SGE sind ohne Gehaltsverlust Umschulungen, Weiterbildungen und sogar Ausbildungen möglich. »Ich hätte gern die Option auf eine höhere Position. Dafür wäre eine Weiterbildung nützlich«, so Katsch.
Momentan überlegt Katsch, wie es nach dem SGE weitergeht. Er will die Entscheidung nicht überstürzen, denn dass es weitergehen wird, scheint ausgemachte Sache zu sein. In dieser Hinsicht hat das Solidarische Grundeinkommen für Katsch bereits jetzt seinen Sinn erfüllt. Sein aktueller Chef empfiehlt ihm, sich schon bald auf eine feste Hausmeisterstelle der Gesobau zu bewerben. Damit würde Mario Katsch lange vor Ablauf seines fünfjährigen SGE-Vertrages in ein reguläres Arbeitsverhältnis wechseln. So unsicher wie noch 2020 sind seine Zukunftsaussichten längst nicht mehr: »Mein Chef will mich auf jeden Fall behalten. Und Zeit für meinen Sohn habe ich dann auch.«
Mario Katschs Porträt und die anderen »Gesichter des SGE« sind hier abrufbar
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.