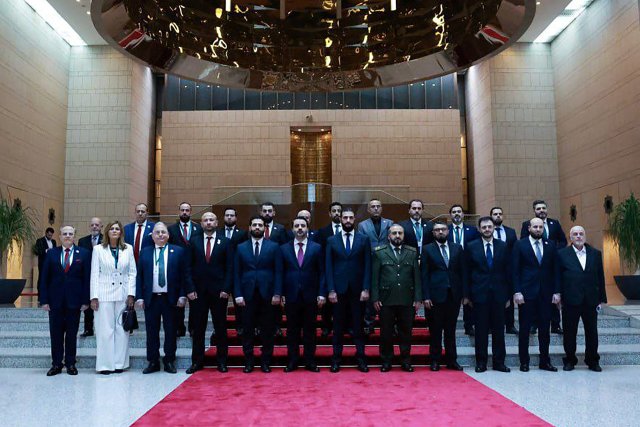- Politik
- Stadtentwicklung
»Das ist wie Familie«
Die ehemalige Betriebsrätin Sabine Jakoby über die Entwicklung der Warenhäuser und das Veröden der Innenstädte

Die längste Zeit Ihres Lebens waren Sie Angestellte bei dem Konzern, der sich jetzt Galeria nennt. Wie kam es dazu?
Sabine Jakoby arbeitete 32 Jahre lang in
einem Warenhaus und sah die verschiedenen Investoren kommen und gehen. Bis zur Schließung ihrer Filiale in Mannheim setzte sich die 49-Jährige als Betriebsrätin für die Rechte ihrer Kolleg*innen ein.
Ich habe mich mit 16 Jahren nach der mittleren Reife dort beworben. Der Berufsberater hat mir eigentlich empfohlen, Goldschmiedin zu werden. Aber ich wollte was Kaufmännisches machen und auch keine Stelle, wo man nur im Büro sitzt. Die Stellenausschreibung im Handel hat sich sehr vielfältig angehört, und dann habe ich einen Eignungstest gemacht. Damals gab es noch in jedem Ausbildungsjahr – bei Horten – mindestens 50 Azubis, also 150 insgesamt, weil es eine dreijährige Ausbildung war. Inzwischen sind ja alle Warenhäuser fusioniert. Aber früher gab es vier: Kaufhof, Karstadt, Herti und Horten. Ich habe diverse Übergänge erlebt – von Horten zu Kaufhof, von Kaufhof zu Galeria Kaufhof, zwischendurch Galeria Karstadt Kaufhof und jetzt zu Galeria.
Werden die notwendigen Qualifikationen für Ihren Job unterschätzt?
Ja, da fehlt die entsprechende Anerkennung. In meinem Arbeitsleben habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen das nicht als eine qualifizierte Ausbildung sehen. Inzwischen machen sich die Arbeitgeber das zu eigen und versuchen damit Tarifflucht oder Abgruppierung zu rechtfertigen. Nach dem Motto: Kassieren kann jeder. Die denken: Ich stell die da hin, arbeite die zehn Minuten ein, dann können die das schon.
Und weil die Kollegin keine Ausbildung hat, bekommt sie weniger Lohn.
Bei Galeria haben sie die Mitarbeiter in verschiedene Teams aufgeteilt. Da gibt es jetzt zum Beispiel nur noch ein Warenservice-Team. Es wird argumentiert, dass für diese Mitarbeiter nur eine gewerbliche Eingruppierung notwendig sei, weil die ja keinen Kundenkontakt haben. Als Kunde ist man aber froh, wenn man überhaupt jemanden findet, selbst wenn der gerade nur ein Regal einräumt. Meistens sind ja auch alle dennoch bemüht, weiterzuhelfen. Aber die Motivation schwindet, wenn ich 600 bis 700 Euro weniger als ein Verkäufer kriege, nur weil ich anders eingruppiert werde.
Was hat Sie bei der Tätigkeit im Warenhaus am meisten gereizt?
Du kannst jeden Tag Menschen glücklich machen. Es ist einfach schön, wenn jemand etwas gesucht hat, du ihm weiterhelfen konntest und er glücklich nach Hause geht. Bei uns sind wir ein tolles Team gewesen, wir hatten eine durchschnittliche Beschäftigtenzugehörigkeit von über 26 Jahren: Das ist wie Familie.
Dennoch kündigte Galeria Karstadt Kaufhof im Zuge eines Insolvenzverfahrens 2020 an, bundesweit fast 50 Filialen zu schließen …
Als Betriebsräte und Beschäftigte haben wir immer gesagt: Wir möchten das Unternehmen retten und leisten dafür auch einen Beitrag. Angesichts der drohenden Insolvenz gab es zuvor Sanierungstarifverhandlungen mit Verdi, in denen Beschäftigte sowohl auf Tariferhöhungen als auch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet haben. Das Insolvenzverfahren kam aber trotzdem. Was ich bis heute verurteile: Uns wurde nicht gesagt, welche Filialen geschlossen werden. Das war der blanke Psychoterror, weil die Kolleginnen bis zuletzt Hoffnung hatten, dass sie gerettet werden – bis zum letzten Tag, als die Türen unserer Filiale endgültig geschlossen wurden.
Was hat das für Reaktionen ausgelöst?
Manche haben sich gleich umgeschaut und relativ schnell eine neue Arbeit gefunden. Es gab aber auch welche, bei denen man wusste: Mist, die arbeiten schon 40 Jahre hier und kennen nichts anderes. Wir hatten unsere schlaflosen Nächte damals. Immer mit der Hoffnung, es geht vielleicht weiter – während wir parallel dazu die Filiale ausräumen mussten. Ich weiß noch, als wir morgens in den Laden kamen, wo über Nacht diese Sale-Plakate in die Schaufenster geklebt worden waren, da sind uns allen erst mal die Tränen gekommen. Das ist schon heftig. Vor allem, weil du weißt: Dieses Unternehmen hat so viele Standorte, aber sie bieten dir keinen Arbeitsplatz in anderen Filialen an.
Was waren die Pläne hinter diesen unternehmerischen Entscheidungen?
Ich denke, der Einbruch kam, als Kaufhof 2015 von Hudson’s Bay Company übernommen wurde. Das ist ein kanadischer Handelskonzern, der uns das goldene Leben versprochen hat. Die haben aber nur so viel Geld wie möglich rausgezogen und uns wieder abgestoßen. Dann kam René Benko, ein Immobilienmogul aus Österreich, der schon vor Jahren Karstadt und die KaDeWe Group übernommen hatte und die Warenhausfusion vorantrieb. Dem gehören ganz viele Immobilien, in denen sich Warenhäuser befinden. Seine eigene Immobiliengesellschaft vermietet unter anderem an Galeria und hat die Mieten so erhöht, sodass kein Gewinn mehr abgeworfen wurde. Das ist rechte Tasche, linke Tasche – zum Nachteil für die Beschäftigten.
Das heißt, von Anfang an war das Interesse an Profit mit Immobilien größer als das Interesse am weiteren Erhalt der Warenhäuser?
Ich glaube tatsächlich, dass der Herr Benko gar kein Interesse am Betreiben der Warenhäuser hat. Er schießt da jedes Jahr viel Geld rein, aber ich erlebe keine Veränderung.
Man könnte ja auch sagen: Dann werden Warenhäuser eben durch Onlinehandel abgelöst, und wir gehen nur noch zum Kaffeetrinken in die Innenstadt. Wo ist das Problem?
Ich möchte nicht nur online einkaufen, und ich bin mir sicher, dass mittelfristig der Onlinehandel auch die Preise für die Logistik erhöhen und zum Beispiel nicht mehr kostenlose Retouren anbieten wird. Was das Einkaufserlebnis ausmacht: Ich sehe etwas, probiere es an, lasse mich beraten, dann treffe ich vielleicht noch meine Freundin, und wir gehen ein Eis essen oder ins Kino. Keine Autos, ich kann mich frei bewegen – das ist meine Vorstellung von einer zukunftsfähigen Innenstadt. Aber viele Innenstädte veröden genau deshalb, weil die Händler vor Ort zumachen. Irgendwann geht dann auch keiner mehr Kaffee trinken.
Welche Rolle hat die Politik bei den Filialschließungen gespielt?
Es sind enorme staatliche Kreditsummen geflossen, aber wir als Beschäftigte haben davon nichts bemerkt. Es ist auch nicht plötzlich mehr oder bessere Ware da gewesen. Statt irgendwelche Beraterfirmen zu beauftragen, hätte ich mir gewünscht, dass man die Filialen fragt: Was braucht ihr? Ich habe nicht verstanden, dass man die zweite Staatshilfe überhaupt noch gegeben hat. Letztlich wurden ja viele Filialen trotzdem geschlossen, und die Beschäftigten verzichten immer noch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Im Gegensatz zu den Beschäftigten vor Ort hat der Herr Benko sicherlich nicht verzichtet. Es ist ein Unterschied, ob eine Teilzeitbeschäftigte, die 2000 Euro brutto verdient, jetzt auch noch ihre paar Kröten Urlaubsgeld nicht kriegt, während Herr Benko die Miete erhöht und am Wochenende mit dem Hubschrauber in die Berge jettet, um mit seiner Frau essen zu gehen. Er hat sich durch den Verzicht der Menschen bereichert, die den Laden am Laufen halten.
Was konnten Sie mit Verdi erreichen?
Ich kann natürlich verstehen, wenn die Gewerkschaft sagt: Wir haben soundso viele Mitglieder in diesem Unternehmen, und wir müssen mit aller Kraft versuchen, es zu erhalten – selbst wenn wir dafür unseren eigenen Flächentarifvertrag unterbieten. Es gibt aber natürlich auch immer persönliche Interessen von Gesamtbetriebsräten. Das sind auch Menschen, die ihren Arbeitsplatz behalten wollen, die sich nach Jahrzehnten im Unternehmen bestimmte Dinge erarbeitet haben: Freistellung, Dienstwagen und so weiter. Und genauso wie bei den Beschäftigten gibt es eben auch Betriebsräte, die Angst haben. Dann hast du eine Gewerkschaft, die in den Spitzengesprächen niemanden verprellen will und nur mehr wie ein zahnloser Tiger wirkt. Im Ergebnis führte das zu einem Interessenausgleich, einem Sozialplan und einem Sanierungstarifvertrag, die alle nicht gut waren.
Die Frage, was mit unseren Innenstädten passiert, ist ja von allgemeinem Interesse. Gab es hier Mobilisierungen?
Es gab auf Initiative einiger Betriebsräte und Gewerkschaftssekretäre vor Ort Gespräche mit Bürgermeistern, Wirtschaftsvertretern und Verbänden. Die Frage lautete: Was passiert denn hier in unserer Stadt? Wenn der Ankermieter schließt, wird dann die Innenstadt veröden? Da gab es viele Briefe von den Bürgermeistern an Herrn Benko, aber das hat den nicht interessiert. Ich hätte mir gewünscht, dass man über diesen Punkt in der Politik mehr diskutiert. Und vor allem, dass man das Geld, das man ins Unternehmen pumpte, auch an klare Bedingungen geknüpft hätte.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.