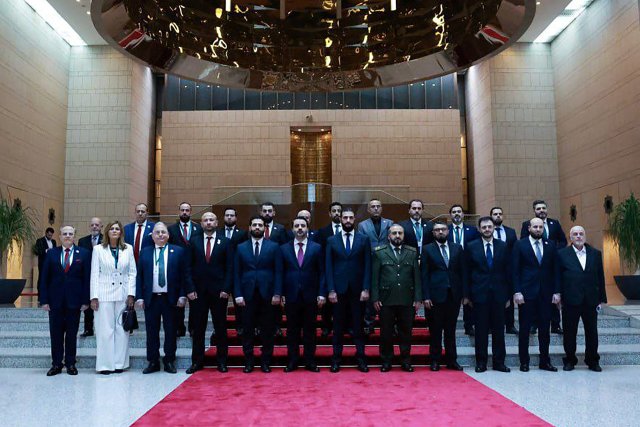- Politik
- Prekäre Beschäftigung
Arbeiten bei NGOs: Werte statt Wert
Nichtregierungsorganisationen leisten unerlässliche Beiträge für die Zivilgesellschaft. Doch die Arbeitsbedingungen lassen häufig zu wünschen übrig

Sie klären über Antisemitismus und die extreme Rechte auf, erstellen Bildungsmaterialien zu Rassismus und setzen sich für die Wahrung der Menschenrechte ein. Sie sind landauf, landab unterwegs, um Workshops zu halten, Ausstellungen zu kuratieren, scheuen auch den Weg in die abgelegenen und strukturschwachen Regionen nicht, um dort demokratische Werte zu vermitteln. Ohne die Arbeit zahlreicher Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wäre es hierzulande um die Aktivität und die Sichtbarkeit der Zivilgesellschaft eher schlecht als recht bestellt. Woran es kaum mangelt, sind öffentliches Lob und Anerkennung für die Vielzahl an Projekten und Kampagnen sowie die dadurch angestoßenen gesellschaftlichen Diskurse. Weniger stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen jedoch die Bedingungen, unter denen diese Arbeit häufig stattfindet.
Um diese zu verbessern und sich über die Möglichkeiten betrieblicher Organisierung auszutauschen, trafen sich am vergangenen Wochenende knapp 50 Mitarbeiter*innen diverser Einrichtungen bei der Konferenz »Arbeiten bei den Guten? Na, herzlichen Glückwunsch!« in Frankfurt am Main. Lukas Schneider arbeitete früher bei einer über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannten NGO und gehört zu den Organisator*innen der Konferenz. Wie sehr Beschäftigten in der Branche das Thema Arbeitsbedingungen unter den Nägeln brennt, habe man bereits im vergangenen Herbst gemerkt, als zu einem ersten Austausch eingeladen wurde. Damals, berichtet Schneider, sei er überrascht davon gewesen, dass es auch bei Beschäftigten anderer Träger »ziemlich hohe Frustration und viel Wut« gegeben habe. Die Gründe, die er im Gespräch aufzählt, bekommt man nahezu wortgleich auch von den übrigen Konferenzteilnehmer*innen zu hören. Von befristeten Verträgen, fehlenden Lohnordnungen und ungeregelten Arbeitszeiten ist da genauso die Rede wie von »Kolleg*innen, die innerhalb der Organisation aufsteigen, entsprechende Aufgaben übernehmen, aber überhaupt nicht geschult sind in Themen wie Personalverantwortung oder Arbeitsrecht«, erzählt Schneider.
Neuland Arbeitsrecht
Von der oftmals eher geringen Bezahlung ganz zu schweigen. Bruttogehälter unterhalb der Grenze von 2000 Euro für Teilzeitstellen seien in der Branche nichts Ungewöhnliches. Einbußen beim Gehalt sind dennoch für viele hinnehmbar, gewissermaßen als Entschädigung dafür, einer Tätigkeit nachzugehen, die als sinnstiftend empfunden wird. Einer Studie der Strategieberatung Deloitte zufolge sehnt sich weltweit über die Hälfte der Menschen zwischen 16 und Ende 30 nach einem Job, mit dessen Werten sie sich identifizieren können. So war es auch bei Lukas Schneider, als er bei der Frankfurter NGO anfing. Er erinnert sich: »Für mich war das der erste richtige Job. Und da startet man dann mit wehenden Fahnen rein, kann endlich zu den Themen arbeiten, mit denen man sich beschäftigen will und bekommt dafür auch noch ein bisschen Geld.« Er habe das »als ein Privileg« empfunden. Doch die anfängliche Euphorie wich der Ernüchterung, als er gemeinsam mit Kolleg*innen einen Betriebsrat gründen wollte. Die Geschäftsführung sei über die Initiative wenig erfreut gewesen, habe diese vielmehr als Affront wahrgenommen. Der Tenor damals: »Wir mussten uns bis heute noch nie mit Arbeitsrecht auseinandersetzen und euer Anliegen macht uns jetzt nur mehr Arbeit«, so Schneider.
Typische Wachstumsschmerzen
André Pollmann ist Bundessekretär für die Branche der Weiterbildung bei Verdi und kennt solche Erzählungen. Seit über zwei Jahrzehnten schon unterstützt er Beschäftigte bei der Gründung von Betriebsräten, hört sich deren Probleme an und führt Tarifverhandlungen. Bei verschiedenen NGOs hat er im Laufe der Jahre ähnliche Probleme beobachten können. Der Klassiker seien kleine Organisationen mit zehn bis 15 Beschäftigten, bei denen die Gründer*innen auch die Chefs sind und von der Arbeitszeit über die Urlaubsplanung bis zum Workload alles untereinander geregelt wird – wenn auch nicht immer im Rahmen der Arbeitsschutzgesetze. »Alles funktioniert wie ein Start-Up von besten Freunden«, sagt Pollmann dem »nd«. Eine häufige Entwicklung: Die Zahl der Mitarbeiter*innen nimmt irgendwann zu, die Organisationen werden größer, professionalisieren sich inhaltlich und methodisch, nur die alten Aushandlungsstrukturen – und damit auch die gemeinsame Gestaltung der Arbeitsbedingungen – bleiben von diesen Wachstumsprozessen unberührt. Wo es früher Teamdiskussionen gab, entscheiden jetzt Vorgesetzte und Sachzwänge. »Das persönliche und kollegiale Du wird zur leeren Hülle«, sagt der Gewerkschafter.
Erschwerend hinzu komme, dass Organisationen teilweise bei der Beantragung von Fördermitteln bei Ministerien und anderen öffentlichen Geldgebern zueinander in Konkurrenz stünden und der dadurch entstehende Druck an die Belegschaften weitergegeben werde. Fehlende betriebliche Mitbestimmung sowie unsichere Beschäftigungsverhältnisse durch sogenannte Kettenbefristungen schürten zudem immer wieder den Unmut der Mitarbeiter*innen. Eine Folge: Aufgrund hoher Fluktuation werden kontinuierlich neue Leute eingearbeitet, mit dem Ende eines Beschäftigungsverhältnisses büßen Organisationen Kontakte und Netzwerke ein, Erfahrungen mit und Vertrauen gegenüber Kooperationspartner*innen müssen beständig und langfristig neu aufgebaut werden. Pollmanns Fazit: »Die Arbeit ist nicht wirklich nachhaltig.«
Um dem entgegenzuwirken, braucht es seiner Auffassung nach eine »gute tarifliche Eingruppierung und klare Spielregeln im Betrieb«. Gleichzeitig müssten die gemeinnützigen Organisationen aber auch lernen, diese Standards gegenüber ihren Auftraggeber*innen transparent zu machen und einzufordern. »Die Einrichtungen müssen auch selber versuchen zu verhandeln und können sich keine Projekte aufzwingen lassen, die nicht ausfinanziert sind«, sagt Pollmann.
Klar definierte Regeln
Bundesweit nimmt das Anne Frank Zentrum (AFZ) aus Berlin eine besondere Stellung in der Branche ein. Dort gibt es nicht nur bereits seit 2009 einen Betriebsrat, 2018 haben die Beschäftigten auch einen Haustarifvertrag erstritten – für dessen Durchsetzung sie sogar einen Warnstreik durchführten. Neben einer Kollektivregelung für Entfristungen gibt es seitdem einen Krankheitsfonds für freie Mitarbeiter*innen. Statt eines hundertprozentigen Ausfalls wird diesen bei Krankheit zumindest die Hälfte ihres Lohnes gezahlt. Jona Schapira ist Referentin beim AFZ und aktiv in der Tarif-Initiative, die derzeit für eine Nachbesserung der Einigung eintritt. Am Rande der Konferenz sagt sie: »Gute Arbeitsbedingungen wirken auf vielen verschiedenen Ebenen. Nicht nur auf einer ökonomischen, sondern auch auf einer psychischen.«
So bedeute Entfristung für Beschäftigte nicht nur eine »enorme Entspannung« in puncto Planungssicherheit. Man könne sich auch »ganz anders gewerkschaftlich organisieren, wenn man weiß, mein Vertrag kann nicht auslaufen«. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Beschäftigte sich auch vermehrt als Lohnabhängige verstehen. Denn so angenehm die Überschneidung von politischer Überzeugung und Arbeitsinhalten für manche auch sein mag, öffnet sie doch gleichzeitig der Selbstausbeutung Tür und Tor. Daher plädiert Schapira für eine strikte Trennung. Sie ist überzeugt: »Wenn ich meine Lohnarbeit mache, dann will ich dafür gerechten Lohn und dass meine Arbeitszeit geregelt ist. Ich will, dass ich richtig eingruppiert werde, dass meine Erfahrung mir wirklich anerkannt wird und Urlaubszeiten geregelt sind.« Schließlich sei das ihre Lohnarbeit. Und nicht ihr Hobby.
Forderungen an die Politik
Während es bei Beschäftigten der Branche großen Redebedarf über Arbeitsbedingungen und betriebliche Mitbestimmung gibt, zeigt sich die Arbeitgeber*innenseite weitestgehend zugeknöpft. Nachfragen bei größeren NGOs werden entweder mit Verweis auf fehlende Kapazitäten aufgeschoben oder bleiben gänzlich unbeantwortet. Eine Ausnahme stellt die Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) dar. Geschäftsführer Timo Reinfrank gibt bereitwillig Auskunft darüber, dass 80 Prozent der Mitarbeiter*innen befristet angestellt sind, etwas weniger als die Hälfte davon »in mehrjährigen Befristungen«, entsprechend der jeweiligen Projektlaufzeiten. Einen hauseigenen Tarifvertrag gäbe es nicht, die Entlohnung sei angelehnt an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes. Zudem seien Vereinbarungen mit dem Betriebsrat bezüglich der Arbeitszeiterfassung sowie Gespräche über weitere Entfristungen in Planung. Ebenfalls habe es in den vergangenen Jahren »erhebliche Investitionen in Professionalisierung, Personalmanagement, Digitalisierung und Infrastruktur und vor allem in die Sicherheit der Stiftung und der Kolleg*innen sowie den Umgang mit Hass, Hetze und Anfeindungen« gegeben.
Um nachhaltig bessere Arbeitsbedingungen sowohl bei der AAS als auch in der gesamten Branche zu ermöglichen, sieht er auch die Politik in der Pflicht. Das von der Bundesregierung geplante Demokratiefördergesetz bleibt Reinfrank zufolge allerdings hinter den im Koalitionsvertrag gemachten Versprechen zurück und werde »in der aktuellen Fassung leider überhaupt nichts an den Rahmenbedingungen für die Träger und die Mitarbeiter*innen verändern«. Wollte man am prekären Status quo wirklich etwas ändern, brauche es »eine Demokratieinfrastruktur, die dauerhaft gefördert werden muss«.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.