- Politik
- Feminismus
Das widerständige Erbe der ostdeutschen Frauenbewegung
Unabgegoltene Geschichte: Die Forderungen der kurzen nicht-staatlichen Frauenbewegung der DDR gingen weit über die Vereinbarkeitsfrage hinaus.

»Wir haben seinerzeit in Küchen zusammengefunden, um patriarchale und undemokratische Verhältnisse zu ändern. Die Erinnerung daran verstehen wir als notwendigen Teil eines Lernprozesses, um auf die drängenden Probleme der Gegenwart Antworten zu finden« (lila offensive 2011).
Ostdeutschland hört nicht auf. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR bleibt Ostdeutschland die viel besprochene und analysierte »Problemzone« (Steffen Mau 2020) des vereinigten Deutschlands. Die Anrufungen der ehemals neuen Bundesländer im öffentlich-medialen Diskurs sind zwar vielfältig, der Tenor jedoch zumeist negativ: brauner Osten, Transformationssumpf, AfD-Hochburg, die kalten blauen Augen von Björn Höcke. Als vermeintlich positive Gegenerzählung, als Lichtblick im Dunkel der deutsch-deutschen Vergangenheitsprojektionen werden in den letzten Jahren verstärkt das Geschlechterverhältnis der DDR und insbesondere die pragmatischen »Ostfrauen« als Erfolgsgeschichte thematisiert. Publikationen wie »Ostfrauen verändern die Republik«, MDR-Sonderreihen über die »Wege zum Glück« der Frauen in der DDR und der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zu 25 Jahren deutscher Einheit sind sich einig: Was von der DDR behalten werden darf, ist der pragmatische Umgang der Frauen mit der Mehrfachbelastung von Kind(-ern) und Berufstätigkeit. Hier bietet das Geschlechtermodell der DDR gar Inspiration für die Herausforderungen der neoliberalen Arbeitswelt, es hat eine Avantgardefunktion für die Gegenwart. (...)
Zukunft und Vergangenheit haben in den Bildern von der Transformationsgesellschaft Ostdeutschland ein Geschlecht. Dabei ist die Passung der »Ostfrauen« und ihrer pragmatischen Vereinbarkeitsfähigkeiten in die gegenwärtige staatliche Familienpolitik stärker von den Veränderungen der Arbeitsorganisation und -anforderungen der letzten 20 Jahre abhängig als von einer verspäteten Anerkennung der emanzipatorischen Potenziale der Geschlechterpolitik in der DDR. In der gesellschaftlichen Konstellation, in der die Vereinbarkeit von Kind und Karriere auch im Geschlechterverhältnis der Bundesrepublik zur Norm des »Adult-Worker-Modells« wird, werden die ehemaligen »Wendeverliererinnen« mit ihrer »Erwerbsneigung« zur positiven Avantgarde einer gelingenden Gleichstellung.
Constanze Stutz ist Soziologin und promoviert im Rahmen des Promotionskollegs »Dialektik der Teilhabe« am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main zu Emanzipationsvorstellungen in den lebensgeschichtlichen Erzählungen von Frauen der ost- und westdeutschen Nachwendegeneration. Eine Langfassung dieses Beitrags erschien zuerst in der Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft Heft 212 mit dem Schwerpunkt »Perspektiven auf Ostdeutschland«.
In diesen politischen Deutungskämpfen wird um gesellschaftliche Teilhabe sowie um sozialen Ein- und Ausschluss gerungen. Und in der Praxis politischer Diskurse wird eine »gesellschaftliche bzw. teilgesellschaftliche Identitätsvergewisserung organisiert« (Stephan Lessenich 2013). Ko-transformiert und unter veränderten Vorzeichen setzt sich damit eine hochgradig symbolische Geschlechterpolitik fort, die bereits das Zeitalter der Systemkonkurrenz charakterisierte. Indem das Bild einer vermeintlich bereits errungenen, widerspruchslosen Emanzipation von Frauen in der DDR fortgeschrieben und sich daran abgearbeitet wird, liefert diese Erzählung für alle Diskursteilnehmer:innen passende Entlastungsmöglichkeiten. Dabei ist der Weg nicht weit zu einem spezifisch ostdeutschen Post- beziehungsweise Antifeminismus, der aktuelle feministische Perspektiven jenseits einer binären Geschlechterordnung als »spezifisch westdeutsch, als falsch aufgestellt und unzeitgemäß markiert«. Von der »Wendeverliererin« zum »deutsch-deutschen Erfolgsmodell« (Sylka Scholz 2020): Diese öffentlich-medial vermittelten Diskursfiguren verdecken nur dürftig die dahinterliegende symbolische Geschlechter- und Familienpolitik als Form gesellschaftlicher Krisenbearbeitung, über die die Desintegration oder Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt sowie dazu passende Zuschreibungen von Geschlechter- und Elternrollen organisiert wird (Gisela Notz 2005).
Dabei bleibt der diskursive Deutungskampf über den Emanzipationsgrad des Geschlechterverhältnisses in der DDR im Dickicht deutsch-deutscher Vergangenheitsprojektionen gefangen: Weder wird das staatssozialistische Geschlechterarrangement in seiner eigenlogischen Widersprüchlichkeit ernstgenommen noch ist Platz für die realexistierende Widerstandspraxis und feministische Politisierung in der DDR und Ostdeutschland. Entgegen diesem Vergessen plädiere ich im Folgenden für eine feministische Erinnerungspolitik, die historische Konstellationen feministischer Konflikte sowie die darin eingewobenen Konzepte, Praktiken und »widerständigen feministischen Visionen« (Ulrike Lembke 2022) perspektiviert und ihnen bis in die Gegenwart folgt. (…)
In den feministischen Organisationsformen und -praktiken finden sich andere Formen der Politisierung der Privatsphäre, die sich aus der gesellschaftlichen Strukturierung von Individuum und Gesellschaft sowie Öffentlichkeit und Privatheit in der staatssozialistischen Gesellschaft ergeben. So zeigt sich ein anderes Bild der kurzen Frauenbewegung: Die 1990 abgebrochene Revolution am Küchentisch der Frauen in der DDR politisierte nicht das Private, sondern machte es öffentlich (Brigitte Studer/Berthold Unfried 2003). (...)
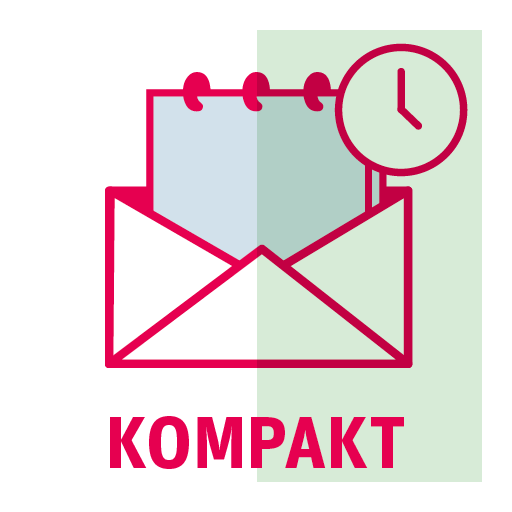
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Wo steckt der (Post-)Sozialismus im Feminismus?
Vielfältige Studien zum »Eigensinn« oder der fortgesetzten »Erwerbsneigung« der ostdeutschen Frauen bis in die Nachwendezeit zeigen, dass Subjektivierungs- und Lebensweisen entlang einer staatlichen Emanzipation durch Integration in die Lohnarbeit verinnerlicht und durch die Transformation hindurch beibehalten wurden. Die selbstverständliche »doppelte Vergesellschaftung« (Regina Becker-Schmidt 2008) in und durch Hausarbeit und Lohnarbeit wurde an die nachfolgenden Töchtergenerationen weitergegeben, obgleich in Zeiten von Flexibilisierung und Prekarisierung »eigentlich nicht mehr die Bedingungen da sind«. Wurde in der Frauen- und Geschlechterforschung lange über die Irritation oder Passung der ostdeutschen Geschlechterverhältnisse in die transformierte gesellschaftliche Wirklichkeit diskutiert, scheint diese Frage in Zeiten der neoliberalen Verdichtung von Lohn- und Reproduktionsarbeit mittlerweile entschieden und die pragmatische, berufs- und familienorientierte »Ostfrau« gilt als »neoliberale[s] Frauenleitbild par excellence« (Scholz 2020).
Die Perspektive auf die DDR zeigt, dass eine Aufhebung der strukturellen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern allein über Integration von Frauen (und anderen aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Gruppen) in die Sphäre der Lohnarbeit nur eine beschränkte Emanzipation bleibt. Denn vergeschlechtlichte Lebens-, Denk- und Deutungsmuster sind langlebig. Zur grundlegenden Veränderung männlicher Herrschaft reicht eine Denaturalisierung des in kapitalistischen Gesellschaften nicht-vergesellschafteten Rests, der unbezahlten Reproduktionsarbeit, nicht aus. Die Erkenntnis, dass aus der spezifischen Konstellation des Geschlechterarrangements in der DDR Widersprüche entstanden sind, die in den konkreten gesellschaftlichen und generationalen Gelegenheitsstrukturen der 1980er-Jahre feministisch politisiert wurden, verweist auf die Widersprüche der Geschlechterordnung in der Gegenwart: Auch in der heutigen Konstellation wird strukturelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern mit der etablierten Gleichheitsnorm legitimiert, Emanzipation auf Lohnarbeit und Produktivität verengt. Auch wenn sich die (neo-)liberale Gleichheitsnorm in entscheidenden Punkten von der sozialistischen unterscheidet – Authentizität, Autonomie, Individualität treten hier an die Stelle von Homogenität als normativem Kern –, zeigt sich ein ähnliches Doublebind: »Gleichstellung als der avancierte Modus weiblicher Emanzipation erweist sich in gewisser Weise als dialektisch: Sie verspricht die soziale Gleichheit zwischen Mann und Frau, bringt aber lediglich die Angleichung an das männliche Ideal. Überwunden wird damit nicht das kapitalistische Patriarchat, überwunden wird nur, was darin einmal das ›Weibliche‹ war«.
Anderes Verständnis von der Politisierung des Privaten
Auch deswegen können uns die feministischen Visionen und die Praxis der kurzen Frauenbewegung der DDR etwas über die möglichen Richtungen der feministischen Politisierung der Gegenwart erzählen. In das Gründungsmanifest des UFV schrieb Ina Merkel: »Der Entwicklungsprozeß der Gesellschaft muß für die Subjekte gestaltbar gehalten werden, er muß in Permanenz erneuerbar und lernfähig sein«. 20 Jahre später reflektiert die lila offensive auf ihre feministische Intervention in den Bewegungsraum 1989/90: »Wir haben seinerzeit in Küchen zusammengefunden, um patriarchale und undemokratische Verhältnisse zu ändern. Die Erinnerung daran verstehen wir als notwendigen Teil eines Lernprozesses, um auf die drängenden Probleme der Gegenwart Antworten zu finden«. Erinnern wird hier als Lernprozess gefasst, der weder abgeschlossen noch widerspruchslos ist. Freie gesellschaftliche Räume und verfügbare Zeit zur gemeinsamen Gestaltung der Gesellschaft, eine Unterordnung der Ökonomie unter die Bedürfnisse der Menschen, ein feministischer Sozialismus: Die Forderungen der kurzen nicht-staatlichen Frauenbewegung der DDR sind nicht eingelöst. Die Praktiken und Visionen der »Küchentischbewegungen« in Mittel- und Osteuropa und der Oppositionsbewegung in der DDR legen ein anderes Verständnis von der Politisierung des Privaten nahe, das heute in demokratischen Bewegungen wie in Belarus oder der feministischen Streikbewegung in Polen gegen die restriktive Abtreibungsgesetzgebung aktualisiert wird. Hier lohnt sich eine weitere Auseinandersetzung mit (post-)sozialistischen Erfahrungen im Feminismus und ihren Verbindungen zu gegenwärtigen Kämpfen und Aushandlungen. Dabei bleibt eine kritische Reflexion der unabgegoltenen Geschichte der sozialistischen feministischen Theorie und Praxis spannungsreich, insofern es sie »die utopischen Momente und die Trauer und Wut ob der Gewalt imperialer, stalinistischer und dogmatischer sozialistischer Politiken zusammendenken muss« (Kitchen Politics 2023).
Gerade angesichts antifeministischer Angriffe, extrem rechter Bewegungen und hasserfüllter Frauenfeindlichkeit ist es von zentraler Bedeutung, Erzählungen von den historischen Frauenbewegungen, die homogenisieren und Widersprüche stillstellen, differenzierte Betrachtungsweisen entgegenzusetzen. Dabei gilt es, kollektive und individuelle Bewegungen für mehr Freiheit und Handlungsfähigkeit als mehrdeutiges Geschehen zu rekonstruieren und sie stets auf ihren konkreten gesellschaftlichen und historischen Kontext zu beziehen. Ein multidirektionales Erinnern, das die Geschichte feministischer Visionen und den demokratischen Aufschwung vor der nationalen Übernahme der Protestbewegungen von 1989/90 nicht in historischen Gedenktagen und -orten versteinert, sondern auf die »Diskussion von Konzepten und Praktiken« (Claudia Jerzak 2017) verlagert, ließe sich in diesem Sinne gestalten. Gerade für feministische Auseinandersetzungen jüngerer Generationen in Ostdeutschland liegt hierin auch eine Möglichkeit, die »Scham, über das Vermächtnis der eigenen – teilweise verstummten – Elterngeneration zu sprechen« zu thematisieren und für eine eigenständige Aneignung zu streiten. Die Frage: »Was wurde auf dem Weg aus dem sozialistischen in das kapitalistische Patriarchat verloren, was muss neu erkämpft werden?« ist auch auf die Gegenwart gerichtet und erfordert ein aktives, kritisches Durcharbeiten des Unabgegoltenen und dessen, was auf dem Weg verloren gegangenen ist. (...)
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.








