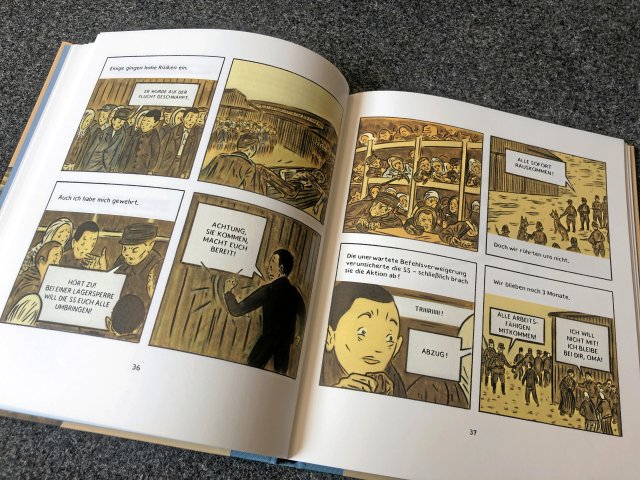- Berlin
- Antifaschismus
Facetten rechter Gewalt in Brandenburg
Ein neu erschienener Sammelband zeigt, wie vielfältig und aggressiv Neonazis in Brandenburg agieren

Am schlimmsten sei es am Anfang gewesen, erzählt sie. Also das erste Jahrzehnt nach dem Mord an ihrem Sohn. Da habe sie nicht arbeiten können. Nicht das Haus verlassen. ›Wenn ich eine Glatze sehe, von Weitem, da krieg ich heute noch Panik.‹ Die junge Frau am Tisch nickt, greift nach der Hand ihrer Mutter.» Diese Szene beschreibt die Schriftstellerin Manja Präkels in ihrem Aufsatz zu rechter Gewalt in Brandenburg.
Am 5. Januar 1992 überfällt ein Dutzend Neonazis die Discothek «Wolfshöhle» in Klein-Mutz bei Zehdenick, Landkreis Oberhavel. Einer der Angreifer versetzt dem 18-jährigen Ingo Ludwig mehrere Fußtritte mit seinen Stahlkappen-Schuhen. Wahrscheinlich wird das Opfer auch noch von anderen Skinheads malträtiert. Aber das lässt sich heute nur noch schwer beweisen. Die Akten existieren nicht mehr. Das Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum sah sich deswegen 2015 außerstande, den Fall noch nachträglich eindeutig zu beurteilen, als es im Auftrag des brandenburgischen Innenministeriums mögliche Fälle von Todesopfern rechter Gewalt nachprüfte, die bis dahin nicht in der Statistik auftauchten.

nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik - aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin - ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.
Für den Verein Opferperspektive aber zählt Ingo Ludwig zu den Naziopfern in Brandenburg seit 1990. Mindestens 23 Tote hat es gegeben. Angeblich war Ingo Ludwig betrunken und sei von selbst eine Treppe hinuntergestürzt. Das soll seinen Tod verursacht haben – nicht die Schläge und Tritte, die er hinterher von Skinheads einstecken musste.
Manja Präkels hat ihren 2017 erschienenen Roman «Als ich mit Hitler Schapskirschen aß» auch Ingo Ludwig gewidmet. Wer das mit einem Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Buch gelesen hat und mit dem Lebensweg der Autorin vergleicht, der erkennt, dass ihre Zeilen autobiografisch inspiriert sind.
Präkels ist in Zehdenick aufgewachsen und war am 5. Januar 1992 in der «Wolfshöhle». Die damals 16-Jährige flüchtete vor den eindringenden Neonazis und versteckte sich. Den Mord an Ingo Ludwig hat sie nicht gesehen, aber gehört. Jahrzehnte später hat sich Präkels noch einmal mit Ingo Ludwigs Mutter Ingrid getroffen und mit seiner jüngsten Schwester Ricarda, die 1992 erst vier Jahre alt war und keine Erinnerungen an ihren Bruder hat. Warum keiner ihrem Sohn geholfen hat? Warum Manja Präkels ihrem Sohn nicht geholfen hat? Das wollte die Mutter wissen. Präkels hatte schlicht nackte Angst. Sie hat sich nicht getraut, aus ihrem Versteck hervorzukommen.
Die heute 48-jährige Präkels hat das schreckliche Ereignis von Januar 1992 nicht nur eindringlich in ihrem Roman verarbeitet. Sie hat nun auch in einem Aufsatz die Szene im Roman entschlüsselt und erzählt, wie langwierig und quälend es war, sich dem Thema schreibend anzunähern. Veröffentlicht ist der Aufsatz in dem neuen Sammelband «Rechte Gewalt – aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg», herausgegeben von Gideon Botsch und Christoph Schulze vom Moses-Mendelssohn-Zentrum sowie von Gesa Köbberling.
Manja Präkels bewegender Beitrag ist nicht die einzige Stelle in dem Sammelband, an der Ingo Ludwig vorkommt. Denn auch Judith Porath, Geschäftsführerin der brandenburgischen Opferperspektive, beschäftigt sich in ihrem Beitrag «Ein Riss, der bleibt» mit der Familie Ludwig, insbesondere damit, wie die Hinterbliebenen den Tod von Ingo verkraftet beziehungsweise nicht verkraftet haben. «Ingos Mutter wurde krank und betäubte als Bewältigungsstrategie ihren Schmerz mit Alkohol, bis eine lebensbedrohliche Erkrankung sie zwingt, mit dem Trinken aufzuhören», schreibt Porath. «Noch heute suchen sie um die Weihnachtszeit, kurz vor Ingos Todestag, Depressionen, Schlafstörungen und Antriebslosigkeit heim.»
Der kleinen Schwester Ricarda sei «ein Stück weit die Kindheit genommen» worden. So formuliert es Ricarda selbst, weil sie wegen der Angst der Eltern, noch ein Kind zu verlieren, selten das Grundstück verlassen durfte und eine Außenseiterin wurde. Der Tod von Ingo wurde für 30 Jahre ein Tabu in der Familie. Ricarda sagt: «Deine Eltern reden nicht darüber. Deine Schwester redet nicht darüber. Aber du merkst, dass was fehlt.» Nur durch Zufall erfährt Ricarda 2022, dass ihr Bruder bei einem Nazi-Überfall zu Tode kam.
Einen Rechtsanwalt genommen hat sich die Familie 1992 nicht. Sie hatte keine Ahnung, wie sie den hätte bezahlen können. Es ist ähnlich wie bei Kathrin Kählke. Ihr Mann Timo will sie am 12. Dezember 1991 von einer Betriebsweihnachtsfeier in Großräschen abholen. Auf der Landstraße sieht er einen Pkw Trabant mit Warnblinklicht stehen und hält an, um zu helfen. Doch die Panne ist vorgetäuscht. Neonazis der Werwolf-Jagdeinheit Senftenberg wollen ein Spielcasino ausrauben, um mit dem erbeuteten Geld bereits gelieferte Waffen zu bezahlen. Für den Überfall brauchen sie ein Fahrzeug. Als Timo Kählke nicht aussteigen will, schießt ihm einer der Täter in den Kopf. Schwer traumatisiert bleibt die 25-jährige Witwe mit zwei kleinen Kindern zurück. Sie berichtet: «In der ersten Zeit, da kommen alle, mit denen man eng ist. ›Wir bleiben heute Abend bei dir, damit du nicht so alleine sitzt‹, sagen sie. Nach einem halben Jahr kommt niemand mehr.»
Ihr Leben verliert sie immerhin nicht, eine Frau, die sich im Sommer 2020 an die Opferperspektive wendet. Die Beraterinnen Anne Brügmann und Lavinia Schwedersky interviewen sie dann 2022 für den Sammelband «Rechte Gewalt». Die junge Frau – sie wird als Amina angesprochen, heißt in Wirklichkeit aber anders – hat eine deutsche Mutter und einen Vater aus Ägypten. Weil man ihr das ansieht, ist sie in ihrem Leben schon öfter beleidigt worden. Doch 2020, in einer Straßenbahn in Brandenburg, da ist es schlimmer als zuvor. Sie ist 18 Jahre alt, schwanger und kommt vom Arzt. Es geht ihr nicht gut. Deshalb trägt sie in der Straßenbahn trotz Corona-Pandemie keine Maske. Ein älterer Mann beschimpft sie erst rassistisch und wird dann handgreiflich.
Das Bedrückende dabei: Fast alle Fahrgäste schauen weg. Nur einer versucht, Amina zu helfen. Er sagt dann auch im Prozess gegen den Täter aus, der schon 23 Vorstrafen auf dem Kerbholz hat und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wird. Ohne die Hilfe des Mannes hätte es auch schlimmer kommen können. Nach dem Vorfall traut sich Amina lange nicht, Bus oder Bahn zu fahren. Inzwischen tut sie das wieder, hat aber ein mulmiges Gefühl dabei. Ab und zu sieht sie den Täter in einem Café sitzen. Sie ist froh, dass er nicht straflos davongekommen ist.
Im Jahr 2020 zählte die Opferperspektive 130 rechte Übergriffe im Land Brandenburg. Im vergangenen Jahr waren es 138. In dem nun im Metropol-Verlag Sammelband finden sich etwa auch Aufsätze über die ersten acht Skinheads in Cottbus und Hoyerswerda, die in den 80er Jahren ins Visier des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit gerieten, und über Neonazis, die im April 1991 mit Krawallen in Frankfurt (Oder) die Grenze für polnische Bürger zeitweise blockierten und Menschen verletzten.
Gideon Botsch, Gesa Köbberling, Christoph Schulze (Hg.): «Rechte Gewalt – aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg». Metropol, 414 S., 26 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.