- Politik
- Rechtsradikalismus
AfD in Ostdeutschland – »Die gefühlte Bedrohung ist entscheidend«
Die Politikwissenschaftler Julian Nejkow und Clemens Kießling erforschen den Nährboden der AfD in Ostdeutschland

Herr Nejkow, in Anbetracht des Umfragehochs der AfD in Ostdeutschland haben Sie ein ungewöhnliches Forschungsprojekt durchgeführt: Sie haben in verschiedenen Görlitzer Kneipen mit Menschen über deren Alltag gesprochen – warum gerade in Kneipen?
Julian Nejkow (J. N.): Es gab eine Schlüsselsituation, eine private Begegnung in einer Kneipe vor einigen Jahren. Ich habe dort ein Gespräch mit jemandem geführt, den ich flüchtig kenne. Am Anfang, als er noch nüchtern und klar war, hat er mir was von Toleranz und gesellschaftlichem Zusammenhalt erzählt. Nach vier, fünf Bieren kamen dann aber die Parolen: Ausländer raus! Abschieben! Diese Veränderung innerhalb von zwei Stunden hat mich erstaunt.
Beim Alkohol werden die Leute eben ehrlich.
J. N.: Ja, genau. Man muss natürlich aufpassen, dass man niemanden befragt, der unter dem Tisch liegt. Aber die Kneipenatmosphäre hat einen großen Vorteil: Man redet ungezwungener.
Was bewegt die Menschen in Ostdeutschland? Diese Frage stellt sich besonders in diesem Jahr mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Um nach Antworten zu suchen, hatten die Politikwissenschaftler Julian Nejkow und Clemens Kießling aus Ostsachsen eine ungewöhnliche Idee: Über Gespräche in Görlitzer Kneipen gewannen sie viele Erkenntnisse über den Blick der Leute auf Politik.
Sie haben dann 10- bis 15-minütige Einzelgespräche geführt. Mit wem haben Sie gesprochen?
J. N.: 70 Prozent unserer Gesprächspartner waren Männer, 30 Prozent Frauen. Das ist ein Kneipenphänomen, nichts Ungewöhnliches. Es waren mehr mittelalte Männer dabei als junge oder ganz alte Menschen, die gar nicht mehr in die Kneipe gehen. Hinsichtlich der Berufe hatten wir eine große Durchmischung, wir hatten aber auch einige Menschen mit relativ schlechter Bildung und einfachen Berufen. Die haben besonders negativ in die Zukunft geblickt. Vor allem Menschen über 50 haben zudem gesagt, dass zu DDR-Zeiten alles besser gewesen sei.
Was treibt die Menschen in ihrem Alltag um?
J. N.: Vor allem Arbeit und Familie. Wir haben das den Mikrokosmos genannt.
Herr Kießling, Sie waren bei der Auswertung der Studie beratend tätig. In Görlitz ist ja wie in vielen anderen Teilen des ländlichen Ostens die AfD sehr stark. Das heißt, bei den Kneipengesprächen kamen auch viele tatsächliche oder potenzielle AfD-Wähler*innen zu Wort. Doch eigentlich spielt Politik im Leben der Menschen eine eher geringe Rolle?
Clemens Kießling (C. K.): Politik wird immer dann interessant, wenn in der gefühlten Wahrnehmung der Makrokosmos sehr in den Mikrokosmos einschneidet. Wenn die Dinge, die von der Bundespolitik zu entscheiden sind, das eigene Leben irgendwie beeinflussen. Beispielsweise haben die Corona-Maßnahmen den Alltag der Menschen grundlegend verändert, dazu haben sie dann Position bezogen.
Dagegen haben sich dann viele Menschen gewehrt.
C. K.: Genau, weil sie diese Veränderung nicht wollten. Dadurch politisieren sich auch Menschen, die lange Zeit entpolitisiert waren. Wir sehen beispielsweise, dass die AfD es auch geschafft hat, Nichtwähler*innen zu mobilisieren. Von der Migrationspolitik über die Pandemie bis zur Energiekrise gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche politische Problemlagen, die auf den Mikrokosmos gewirkt haben.
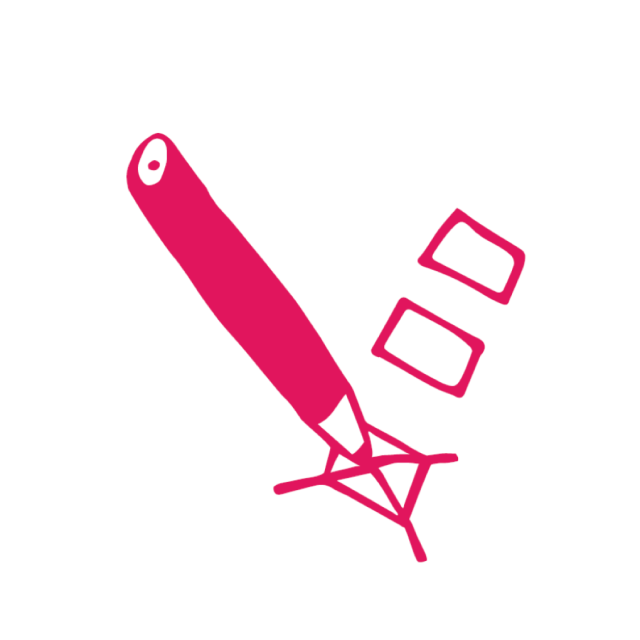
Das Wahljahr 2024 ist kein beliebiges. Schon lange nicht mehr war die Zukunft der Linken so ungewiss, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren die politische Landschaft und die Wählerschaft so polarisiert, noch nie seit der NS-Zeit war eine rechtsextreme, in Teilen faschistische Partei so nah an der Macht. Wir schauen speziell auf Entwicklungen und Entscheidungen im Osten, die für ganz Deutschland von Bedeutung sind. Alle Texte unter dasnd.de/wahljahrost.
Wobei es ja durchaus Unterschiede gibt. Beispielsweise sind die Energie- und Lebensmittelpreise tatsächlich gestiegen. Da gab es eine Auswirkung auf den Geldbeutel der Menschen. Hingegen verändern mehr Geflüchtete den Alltag von Menschen, die in Deutschland geboren wurden, nicht zwangsläufig.
J. N.: Die gefühlte Bedrohung ist entscheidend. Interessanterweise haben viele Menschen nämlich auch gesagt, dass es ihnen persönlich ganz gut gehe. Gleichzeitig sehen sie ihren Wohlstand bedroht, etwa von Menschen, die nicht arbeiten oder nicht aus Deutschland kommen. Und die AfD bietet dagegen als Medikament das Versprechen an, den Makrokosmos aus ihrem Mikrokosmos herauszuhalten.
Heißt übersetzt?
J. N.: Du musst dich nicht um Corona kümmern, das ist nur eine einfache Erkältung. Du musst dich nicht um Migration kümmern, die wollen wir sowieso nicht. Die Nebenwirkung des Medikaments ist, dass das, was dort versprochen wird, gar nicht einhaltbar ist.
Wir sehen also eine große Angst vor Veränderungen. Spielt dabei auch eine Rolle, dass Menschen sich seit der Wende etwas erarbeitet haben und nun Angst haben, das wieder zu verlieren?
C. K.: Genau. Es gab bis 1990 keine Möglichkeit, Vermögen aufzubauen oder zu akkumulieren. Und es gibt bis heute große Vermögensunterschiede gegenüber dem Westen. Im Osten wird viel weniger vererbt. Wenn es zu realen Verlusten kommt, dann sind diese im Osten deutlich stärker spürbar. Die Mittelschicht in Ostdeutschland ist deshalb sehr fragil. Hinzu kommt, dass wir mit den regierenden Parteien eine Art Vertrag abschließen.
Wie meinen Sie das?
C. K.: Wir geben einen Teil unserer Freiheit auf, dafür wollen wir die Garantie für Sicherheit. Die Politik soll das, was wir uns aufgebaut haben, absichern. Wenn man diese Sicherheit nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stellt, dann suchen sich Ostdeutsche deutlich schneller eine Alternative, weil sie generell weniger Vertrauen ins System haben.
J. N.: Dazu muss man aber auch sagen, dass von den Ostdeutschen nach 1990 viel erwartet wurde. Es wurde erwartet, dass alles glattgeht mit dem Kennenlernen des Fremden, des Neuen. Auch mit dem Kennenlernen von Menschen aus Ländern, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Das war in den 60er Jahren im Westen, als die Gastarbeiter*innen kamen, nicht anders. Die NPD ist sprunghaft angestiegen und wäre 1969 mit 4,3 Prozent fast in den Bundestag eingezogen. Mehrere NPD-Landesverbände sind in Landtage eingezogen.
Hat die Politik nach 1990 zu viel von den Ostdeutschen erwartet?
J. N:: Jedenfalls hat man eine Leistung des Lernens und des Umsetzens erwartet von Menschen, die das System noch nicht lange kannten und von Systemen mehrfach enttäuscht wurden. Menschen, die in den 90er Jahren, wenn wir über die Treuhand reden, sogar verarscht wurden. Für viele Leute war das keine einfache Zeit. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man sich alles erlauben kann.
Jetzt stehen wir vor dem Problem, dass die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, allen voran die Klimakrise, ohne Veränderungen nicht zu meistern sind. Beispielsweise müssen wir die Art, wie wir uns fortbewegen oder unsere Wohnung warm halten, über kurz oder lang verändern. Der Mikrokosmos kann also nicht so bleiben, wie er ist. Wie kann man das schaffen, wenn Menschen dafür gar nicht bereit sind?
C. K.: Historisch ist das zunächst einmal überhaupt nichts Neues. Immer dann, wenn gesellschaftliche Systeme sich wandeln, gibt es große Verunsicherungen. Da gibt es auch Phasen, in denen Menschen in die Radikalität abdriften, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Wir dürfen nur die Fehler, die wir gemacht haben, nicht wiederholen. Wir leben heute in einem Kommunikationszeitalter: Fernsehen, Radio, Social Media. Wir müssen viel deutlicher und vor allem verständlicher kommunizieren, worauf es ankommt, ohne diejenigen auszuschließen, die es nicht gleich verstanden haben.
J. N.: Wir müssen aber auch Menschen befähigen, mit den sozialen Netzwerken überhaupt umzugehen. Ich möchte jetzt nicht alle Männer Mitte 50 über einen Kamm scheren. Aber die glauben schon, dass sie mit Facebook ganz gut umgehen können. Wir wissen aber aus Studien, dass 50- bis 60-Jährige deutlich mehr Fake News teilen als Menschen, die mit diesen Medien aufgewachsen sind. Zudem gibt es im Osten ein Problem mit dem Begriff Lernen.
Inwieweit?
J. N.: Den Ostdeutschen wurde nach der Wende suggeriert, dass alles, was sie im Osten gelernt haben, nichts mehr wert ist. Umso allergischer reagieren einige Menschen heute darauf, wenn sie etwas lernen sollen. Wir werden es nur mit sehr viel Kraft, Anstrengung und dem Willen aller schaffen, wieder als Gesellschaft zusammenzufinden. Die Zahl der Menschen in Ostdeutschland, die trotzig sind, ist aktuell so groß, dass wir erst einmal schauen müssen, wie wir mit denen wieder persönlich ins Gespräch kommen. Aber zurück zur Ausgangsfrage: Wenn wir genau wüssten, an welchen Schrauben wir drehen müssen, dann würden wir hier heute nicht sitzen.
Was haben Sie noch gelernt bei den Kneipengesprächen?
J. N.: Viele unserer Gesprächspartner*innen nahmen sich viel Meinung heraus, auch wenn sie wenig Wissen haben. Mehr Demut in der Kommunikation würde uns gut stehen. Im Westen schon immer, aber im Osten mittlerweile auch.
Würden die Menschen anders mit Krisen umgehen, wenn sie mehr Wissen über Phänomene wie den Klimawandel hätten?
J. N.: Und wer soll ihnen das sagen? Wir haben eine verbreitete Trotzhaltung in der Gesellschaft. In der Corona-Zeit haben wir eine harte Abwertung der Wissenschaft erlebt, weil den Menschen gar nicht klar war, dass Wissenschaft von Irrungen lebt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir diejenigen, die zum Beispiel auf Querdenken-Demonstrationen gehen, vernünftig aufklären, ohne dass sie sich sofort auf den Schlips getreten fühlen.
Was heißt für Sie, dass mehr Demut notwendig sei?
C. K.: Es geht darum, Vertrauen zu stärken. Wenn meine Karre gerade nicht funktioniert, gehe ich zum Kfz-Mechatroniker ...
J. N.: … aber wenn Politik nicht funktioniert, gehen viele Leute nicht mehr zum Politiker, sondern sie wollen gleich das ganze System absägen. Das liegt aber auch daran, dass viele Parteien den Osten ein Stück weit aufgegeben haben. Vertrauen schaffen geht nur, wenn Politik das auch will und vor Ort wieder stärker präsent ist.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







