- Wirtschaft und Umwelt
- Gesundheitspolitik
Leipzig: Ein Krankenhaus als Intensivpatient
Krise im Gesundheitswesen: Kommunales St.-Georg-Klinikum musste mit Millionenspritze von der Stadt gerettet werden

Geldmangel war schon ein Problem, als das Leipziger Klinikum St. Georg seine heutige bauliche Gestalt erhielt. Von 1908 bis 1913 wurde für das Krankenhaus, das sich in der Tradition eines bereits 700 Jahre zuvor gegründeten gleichnamigen Hospitals sieht, ein Neubau im damals populären Pavillon-Stil errichtet: Bettenhäuser und Stationen, die in einem weitläufigen, parkartigen Gelände verteilt sind. Allerdings sorgten schon damals Sparmaßnahmen dafür, dass nicht alle der geplanten Gebäude entstanden.
Gut 100 Jahre später ist das Geld wieder knapp bei dem Klinikum – so knapp, dass Ende April die Insolvenz gedroht hätte, wenn die Stadt als Trägerin nicht kurzfristig tief in die eigene Kasse gegriffen hätte. Vor gut einer Woche beschloss der Stadtrat, den Fehlbetrag für das Jahr 2023 in Höhe von 37,7 Millionen Euro auszugleichen. Ein erst im vergangenen Frühjahr eingeräumter Kreditrahmen von damals 100 Millionen Euro wurde jetz verdoppelt, die Laufzeit um zwei Jahre bis Ende 2029 verlängert. Außerdem wurde auch eine Bürgschaft für Kredite aufgestockt, mit denen ein im Bau befindliches neues Zentralgebäude finanziert werden soll. Sie beträgt jetzt 70 statt 60 Millionen Euro.
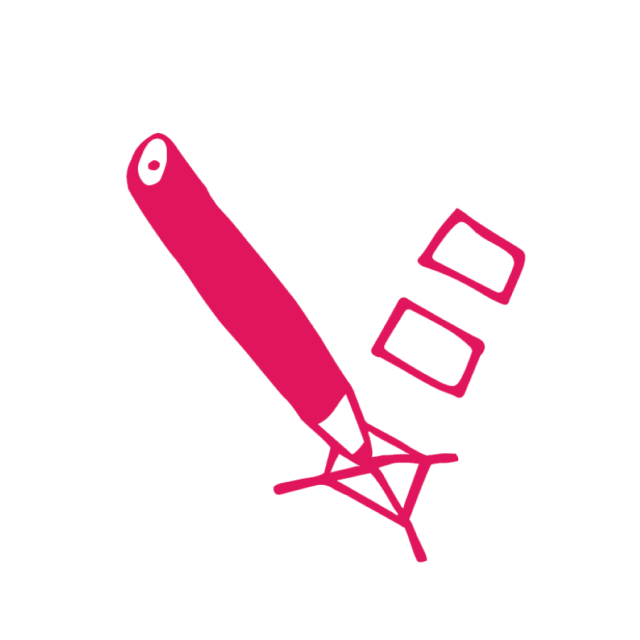
Das Wahljahr 2024 ist kein beliebiges. Schon lange nicht mehr war die Zukunft der Linken so ungewiss, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren die politische Landschaft und die Wählerschaft so polarisiert, noch nie seit der NS-Zeit war eine rechtsextreme, in Teilen faschistische Partei so nah an der Macht. Wir schauen speziell auf Entwicklungen und Entscheidungen im Osten, die für ganz Deutschland von Bedeutung sind. Alle Texte unter dasnd.de/wahljahrost.
Der Neubau soll eines der eher spezielleren Probleme von St. Georg lindern: die »überproportional hohen Betriebskosten«, die zum Beispiel für das Beheizen der »alten Liegenschaften« in Gestalt der Pavillons anfallen. Daneben führt die Geschäftsführung in einer Erklärung für die schwierige Lage aber auch die Corona-Folgen, die hohe Inflation und die von guten Tarifabschlüssen verursachten Personalkosten für die 2700 Mitarbeiter an. Beobachter verweisen zudem auf die Folgen von allgemeinen Umstrukturierungen im Krankenhausbereich. Weil immer mehr Operationen ambulant statt stationär durchgeführt werden, sinkt die Bettenauslastung und es fehlen Einnahmen.
All das sind Probleme, die viele Krankenhäuser in Deutschland plagen. Von diesen schrieben 80 Prozent rote Zahlen, ein Drittel sei insolvenzgefährdet, betont das Management von St. Georg. Abhilfe soll eigentlich eine bundesweite Krankenhausreform bringen, die das bisherige System der Kostenpauschalen um Zuschüsse für das Vorhalten bestimmter Leistungen und Betten ergänzt. Die Reform verzögert sich aber seit Jahren; es gibt Streit zwischen dem Bund und den für die Krankenhausplanung zuständigen Ländern. Im Januar hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, sie auch ohne deren Zustimmung durchzusetzen. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen warf ihm daraufhin vor, »sehenden Auges weiterhin das bereits begonnene Sterben von Krankenhausstandorten in Kauf« zu nehmen.
Ein solches hat in Sachsen bereits in gravierendem Ausmaß stattgefunden. Seit 1992 wurden 34 von einst 112 Krankenhäusern abgewickelt, gleichzeitig fiel die Hälfte der knapp 43 000 Betten weg. Das geht aus Zahlen hervor, die Sören Pellmann, Leipziger Abgeordneter und Ko-Gruppenchef der Linken im Bundestag, beim Statistischen Bundesamt erfragte. In ganz Ostdeutschland vielen demnach 93 der 366 Häuser weg. In Sachsen wurde zuletzt Ende 2023 das Krankenhaus im vogtländischen Reichenbach geschlossen. In der Oberlausitz steht angesichts eines Millionendefizits des kommunalen Krankenhausbetriebs die Zukunft des Klinikums Ebersbach in Frage. Im Leipziger Umland droht der Einstieg eines privaten Investors bei den Muldental-Kliniken.
Einen Teil der Probleme hat das Land zu verantworten, sagt Susanne Schaper, Landeschefin der Linken. Unter anderem würden den Kliniken »seit Jahren Investitionsmittel in Millionenhöhe vorenthalten«. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft decken die Länder nur etwa die Hälfte des »bestandserhaltenden Investitionsbedarfs«, der zuletzt bundesweit auf sechseinhalb Milliarden Euro beziffert wurde. Schaper, die selbst Krankenschwester ist, verweist zudem auf einen in Sachsen zu geringen »Landesbasisfallwert«, also die jährlich vereinbarte Vergütung für stationäre Leistungen. Die Linke will im Wahlkampf für die Landtagswahl im Herbst verstärkt auf die schwierige Lage der Krankenhäuser hinweisen: »Das ist eines unserer Kernthemen«, sagte Schaper.
Andere hoffen auf die geplante Reform im Bund. Von dieser erwarte man eine »solide Neuordnung der Finanzierung«, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): »Sie muss jetzt aber kommen.« Pellmann ist skeptischer. Er fürchtet, dass »mit Lauterbachs Reformen weitere Schließungen drohen«, und rügt, der Bund wälze Milliardendefizite der kommunalen Kliniken auf Städte und Landkreise ab, die davon überfordert sind. Leipzig, sagt Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) angesichts der Krise von St. Georg, könne »auf Dauer weder die Ineffizienzen des Klinikums noch Fehler in der deutschen Krankenhausfinanzierung ausgleichen«.
Der städtische Zuschuss sei unausweichlich gewesen, sagt Bonew, weil es sonst »nur die Insolvenz als Alternative« gegeben habe. Das aber könne »nicht die Regel werden«. Dem stimmt Linke-Stadtrat Steffen Wehmann zu. Man stehe »uneingeschränkt« zum städtischen Klinikum, betont er: »Aber wir können unserem Krankenhaus kaum im Zweijahresrhythmus fast eine Viertelmilliarde zur Verfügung stellen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







