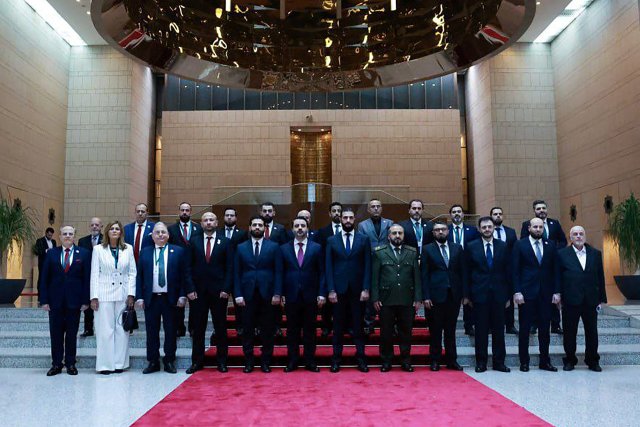- Politik
- Lateinamerika
Kolumbien: Und nachts fielen wieder Schüsse
In Kolumbien herrscht trotz aller Bemühungen der Regierung kein Frieden. Das spüren die Menschen vor allem in Dörfern in ländlichen Gegenden

Immer nachmittags legt sich Nebel über Amalfi, manchmal so dicht, dass man nicht einmal mehr die Fassade der Nachbarhäuser direkt gegenüber erkennen kann. Manche sagen, dass dieser Nachmittagsnebel über dem Tal, in dem das Dorf liegt, die Schönheit Amalfis ausmacht. Andere sagen, ihnen macht der Nebel Angst. Auch, weil es immer dieses diffuse Unsicherheitsgefühl gibt, so als könnte jederzeit etwas Schlimmes geschehen – und viel zu oft passiert es auch. Das Leben vieler Jugendlicher in Amalfi hängt am seidenen Faden.
Seit etwa einem Monat hat eine paramilitärische Gruppe eine Ausgangssperre ab 22 Uhr verhängt. Die Macht der Paramilitärs zeigt sich darin, dass tatsächlich am späten Abend Türen und Fenster geschlossen, Vorhänge zugezogen werden. In manchen Wohnungen läuft noch der Fernseher.
Lediglich im Vergnügungsviertel – der Zona Rosa, im Dorfzentrum, leuchten spätnachts noch einige Lichter der Bars, lauter Reggaeton oder Vallenato schallt aus den Boxen, Cocktails gehen über die Theke. Einige Jugendliche, die einfach jung sein wollen und einige ältere Stammgäste tanzen und trinken trotz des dunklen Schleiers, der sich über das Dorf legt.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Lassen die Paramilitärs Gnade walten oder haben sie selbst ein Interesse, dass die Geschäfte mit dem Nachtleben weitergehen? Fragen, auf die Gesprächspartner in Amalfi viele Antworten haben, aber die, die es wirklich wissen, sagen lieber nichts dazu.
Im Viertel Pueblo Nuevo, wo die Straßen nicht asphaltiert sind und viele Häuser Wellblech- statt Ziegeldächer haben, etwa zehn Minuten zu Fuß vom Dorfviertel entfernt, sind schon nach acht Uhr die Straßen leer und die Fenster zu. Das gilt selbst am Wochenende, an dem doch eigentlich Freund*innen oder Tanten zu Besuch kamen und man bis spät in die Nacht viele Runden Aguardiente ausschenkte, grillte und dabei über den neuesten Familientratsch oder Neuigkeiten aus dem Dorf plauderte. Trotz allem Katholizismus – oder in letzter Zeit auch strengster Freikirchenpräsenz – durfte dabei der eine oder andere schmutzige Witz nicht fehlen, woraufhin alle laut lachten, so laut, dass manchmal die Nachbarn dazukamen und eine Runde mittranken.
Auch über die Gewalt im Dorf wurde dann gesprochen, allerdings eher im Familienkreis und nur leise, flüsternd oder mit vorgehaltener Hand. Denn es war immer besser, wenn keiner wusste, dass man etwas wusste – obwohl eigentlich alle irgendwie Bescheid wussten, was in letzter Zeit im Dorf los war.
Im Prinzip hatte es kurz nach Neujahr begonnen. Gleich in den ersten Tagen machte die Nachricht die Runde, dass eine Goldminenbesitzerin aus Amalfi an einer Tankstelle in der Nähe der Großstadt Medellin von Auftragsmördern erschossen wurde. Durch die sensationsfreudige Presse ging ein Foto von einem Hummer mit getönten Scheiben und offener Fahrertür, neben der ein Plastiksack die Leiche bedeckte. Durch Amalfi wiederum ging die Sorge, dass dieser Mord weitere nach sich ziehen könnte.
Jedes Jahr am 6. Januar findet das größte Fest des Jahres in Pueblo Nuevo statt. Auf einer kleinen Bühne auf dem zentralen Platz spielte eine landesweit bekannte Band, die internationale Reggaetonhits covert und mit regionalen Texten versieht, die dann von allen lautstark mitgesungen wurden. Als es bereits nach Mitternacht war und sich der Platz langsam lichtete, obwohl die Band noch spielte, gingen auch wir nach Hause. Auf dem Heimweg stoppten wir kurz an einer Ecke des Platzes und blickten auf den Boden, auf dem sich eine dickere rote Flüssigkeit mit Schmutz und Regenrückständen auf der Straße vermischte. »Das ist Blut«, sagte ein Freund und ein anderer, den wir nicht kannten, sagte im Vorbeilaufen: Da ist vorhin einer erstochen worden. Mehr erfuhren wir über den Vorfall – wie es in Beamtensprache heißt – auch an den folgenden Tagen nicht.
Nur wenige Tage danach hörten wir gegen 21 Uhr Schüsse in Pueblo Nuevo. Eine Tante meinte zunächst, es wären noch ein paar verspätete Neujahrsraketen, aber der Onkel, der bereits viel erlebt hatte, wusste sofort, dass es Pistolenschüsse waren. Man konnte sie leicht am Knall – weniger Hall und Echo – unterscheiden und an der Frequenz, in der die Schüsse abgegeben wurden.
Als wir weitere Schüsse gleich um die Ecke hörten, machten wir das Licht aus, schlossen die Vorhänge, versteckten uns unter den Fenstern und lugten vorsichtig hinaus; sahen aber nur eine leere Straße. Am nächsten Morgen erfuhren wir im Gespräch mit weiteren Familienmitgliedern, was passiert war: Der Chef der Bande, die bisher Amalfi kontrolliert hat, und sein Leibwächter sind erschossen worden.
Diesmal gab es nicht nur Dorffunk, sondern auch wieder Zeitungsartikel. Dort stand, was wir eh schon wussten: Dass möglicherweise die größte paramilitärische Gruppe des Landes, der Clan del Golfo hinter dem Mord steckt, um eine rivalisierende Gruppe um die Einnahmen aus Drogenhandel, Goldbergbau und Schutzgelderpressung aus Amalfi zu vertreiben.
Längst machte im Dorf ein Video die Runde, das vier vermummte, schwer bewaffnete Männer in Uniform ohne Abzeichen zeigte, die eine Ausgangssperre und eine »Limpieza social«, eine Soziale Säuberung in Amalfi ankündigten. Ein Begriff, den rechte Paramilitärs seit den 80er Jahren in Kolumbien prägten. Mit der Säuberung meinen sie die Ermordung von Obdachlosen, Homosexuellen und linken – vermeintlichen – Unterstützer*innen der marxistisch orientierten Guerillas.
Eine solche linke Guerilla gibt es in den ländlichen Teilen Amalfis, die teilweise mehrere Stunden mit dem Auto und anschließend mit dem Pferd entfernt sind – bis heute: die Nationale Befreiungsarmee ELN. Im Dorf reden manche – vor allem Bergleute – mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Respekt von ihr. Doch wer nicht in die Tiefen der Berge Antioquias reist, hat kaum Berührung mit der letzten verbliebenen Guerilla.
Diese nun angekündigte Limpieza Social in Amalfi richtet sich gegen Unterstützer*innen der rivalisierenden paramilitärischen Gruppe – und auch gegen Obdachlose, Sexarbeiter*innen, Drogenkonsumierende, Diebe, um die mordende Gewalt vor einem Teil der Bevölkerung zu legitimieren.
Dieser Teil äußerte sich gleich nach Erscheinen des Videos in den Whatsapp-Gruppen Amalfis, in denen fast alle im Dorf Mitglied sind. Endlich räume mal jemand auf, wenn das der Staat nicht tut, hieß es dort. 34 Likes. Eine vorsichtig formulierte Nachricht eines anonymen Profils, das widersprach und stattdessen Frieden und ein Ende der Gewalt forderte, kam auf 19 Likes. Wenn vielleicht auch deutlich mehr zustimmten, trauten sie sich vielleicht nicht, das auch zu zeigen. Schweigen über das Sterben der anderen kann das eigene Leben retten, denken viele.
Nur wenige Tage nach Erscheinen des Videos verschwand ein Junge, der im Dorf unter dem Spitznamen Tula bekannt war – und dafür, auf der Straße zu leben. Einen Tag später wurde er tot am Rande eines Waldstücks etwas außerhalb des Dorfes gefunden. Das Bild der Leiche machte auf Whatsapp die Runde, neben Kommentaren des Mitgefühls und der Trauer reihten sich auch Anschuldigungen wie »Selbst schuld, wer den Drogen verfällt«.
Ebenfalls über Whatsapp verbreitete sich der Link zu einem Facebookprofil: Kürzlich erstellt, als Profilbild ein Totenkopf, in den Posts hieß es, die »Soziale Säuberung« in Amalfi habe begonnen, sowie diverse Fotos von Personen; die als nächstes ermordet werden sollten.
In Amalfi sind Opfer und Täter Nachbarn. Wobei die Täter oft auch selbst Opfer sind. Jugendliche, die nie eine Chance hatten, der Gewalt zu entkommen. Die Armut, die leeren Kühlschränke zu Hause, Familiengenerationen, die im kolumbianischen Krieg seit einem halben Jahrhundert versuchen zu überleben. Täter, sind auch die, die Gewalt legitimieren – und vor allem die, die sie mit staatlicher Macht am Leben halten, weil sie davon profitieren.
Die den Jugendlichen in den Dörfern in Amalfi ein zusätzliches schweres Gewicht auf die Schultern legen. Zusätzlich zur patriarchalen, ökonomischen und rassistischen Gewalt, die die Gesellschaft eh schon in sich trägt.
Im Alltag ist dieses Gewicht nicht unbedingt sichtbar. Noch nicht einmal in diesen Tagen in Amalfi, ließ sich die Normalität ganz verdrängen: Motorräder konkurrierten mit Fahrrädern und Fußgängern auf den engen Straßen. Zehnmal am Tag fuhr der Bus nach Medellín. Am Nachmittag füllte sich die Kirche stärker als morgens. Kinder spielten – noch in ihren Schuluniformen – auf den Bürgersteigen. Straßenverkäufer boten Eis, Süßigkeiten oder Empanadas an.
Erst abends, im Kreis der Vertrauten, blieb etwas Raum für Angst und Sorge und den Versuch, zu verstehen, was da grade im Nebel Amalfis vor sich ging. Einer meinte, die Sprache, die im Facebookprofil verwendet wurde, sei typisch für jene, die Polizisten in der Vergangenheit verwendeten, zum Beispiel, wenn sie mit Paramilitärs kooperierten oder sich als diese ausgaben. Andere meinten, das Profil sei ein Fake und von einer Einzelperson verfasst, die gar nichts mit den illegalen bewaffneten Gruppen zu tun hatte. So wie vor einigen Jahren, als ein gieriger Amalfitaner vermeintliche Bedrohungsschreiben von Paramilitärs verfasst und diese unter dem Türrahmen der Nachbarn hindurchgeschoben hatte, in der Hoffnung, dass diese daraufhin das Dorf verlassen und er das Haus günstig für seine Mutter kaufen könne.
Was aber auf jeden Fall echt war, war der Vorfall, von dem eine besorgte Mutter in ihrer Sprachnachricht berichtete. Ihr Sohn war am Vorabend erst gegen 21 Uhr aus der Schule gekommen. Auf der Straße hatte ihn eine Gruppe Männer angehalten und ihm sein Handy weggenommen. Sie sagten, dass sie ihn schlagen werden, falls sie etwas auf dem Handy finden über »das, was gerade passiert«. Manche besorgten sich daraufhin ein gebrauchtes, zweites Handy, das sie niemals mit aus dem Haus nahmen.
In den folgenden Nächten hörten wir nachts wieder Schüsse in Pueblo Nuevo, aber wie es schien, gab es diesmal keine Toten. In einer anderen Nacht kam der Knall diesmal tatsächlich von einem Feuerwerk, Nachbarn feierten einen Familiengeburtstag.
In Amalfi übernehmen kleine Tuk-Tuks, dreirädrige Motorräder mit Fahrerkabine und Platz für zwei Passagiere, den lokalen Transport. Die dreirädrigen Motorräder werden wegen der Scheinwerfer, die gemeinsam mit dem vorne spitz zulaufenden Gehäuse an das Gesicht einer Maus erinnern, Motoratón (Motormaus) genannt. Die Motoratón-Fahrer sind in einer Kooperative organisiert und im Dorf recht angesehen.
An einem Samstag in den frühsten Morgenstunden fragte einer der Fahrer in einer Whatsapp-Gruppe, ob ihm jemand eine Bergarbeiterlampe ausleihen könnte. Er wolle einen Kollegen suchen, der seit gestern Nachmittag nicht mehr aufgetaucht war. Einige Stunden später schrieb er: »Wir haben sein Motorrad in der Nähe der Müllkippe gefunden – ohne Fahrer.« Wenige Minuten später: »Wir haben ihn gefunden – tot.«
Diesmal war die Entrüstung in Amalfi größer als das Schweigen. Zur Beerdigung kamen viele, wirklich viele Menschen, die keine Familienangehörigen waren und begleiteten den weiß gekleideten Trauerzug mit weißen Luftballons über den zentralen Platz. Der Trauerzug wurde zu einer Demonstration gegen die Gewalt.
Selbst die nationale Presse wurde aufmerksam, und staatliche Stellen kündigten an, die militärische Präsenz in Amalfi zu erhöhen. Zuerst fuhr eine Spezialeinheit der Polizei mit Maschinengewehren auf Pick-ups Patrouille durch das Dorf. Dann filzten Polizisten und Soldaten am Ortseingang jedes Auto, das nach Amalfi fuhr.
Doch am selben Tag erreichte mein Handy das Foto eines Jungen, der mir irgendwie bekannt vorkam, vermutlich, weil er neben dem Kiosk wohnte, an dem ich morgens Arepas, Käse und manchmal auch Eier kaufte. Er trug eine Cap, weite Shirts und manchmal Jeans oder Jogginghose. Nicht nur wegen seiner Zahnspange schätzte ich ihn auf höchstens 14 Jahre.
Am Nachmittag seien vermummte Männer in sein Haus eingedrungen und hätten den Jungen vor den Augen seiner Mutter und Schwester aus dem Haus geholt, aufs Motorrad gehievt und seien verschwunden, hieß es. Die Schwester habe noch versucht, auf ihrem Moped die Vermummten zu verfolgen, doch sie seien entwischt. Die Familie suchte nach Hinweisen, doch niemand wusste wirklich zu helfen. Viele fragten, wie das geschehen konnte, während das Dorf voll von Polizisten und Soldaten war, und einige munkelten, die Vermummten seien selbst Polizisten gewesen.
Drei Tage später tauchte der Junge wieder auf. Ein Bekannter meinte, es hätte sich bei der Entführung um eine reine Erziehungsmaßnahme gehandelt. Das sei doch gar nicht so schlecht. Eine Woche später wurde der Junge vor seinem Haus erschossen.
Ich ging auch die nächsten Tage weiter zum selben Kiosk. Bisher mochte ich die Straße. Sie war wie die meisten in Pueblo Nuevo nicht asphaltiert, und auf dem sandigen Boden spielten Jungs, manchmal auch gemeinsam mit Mädchen, Fußball oder kurvten auf kleinen Fahrrädern durch den Sand zwischen den Steinen. Heute war es leerer. Ich setzte mich mit einem kühlen Getränk einen Moment vor den Kiosk, dann sah ich einen der Jungs, wie er hinter einer Hauswand hervorlugte, zurückwich und sich dann langsam um die Ecke wandt. In seiner Hand hielt er eine Wasserpistole. Als der Junge von gegenüber plötzlich – ebenfalls mit einer Wasserpistole in der Hand – über die Straße rannte, wagte sich auch der erste aus der Deckung und beide zogen den Abzug, schossen mit Wasser aufeinander. Sie lachten. Sie spielten. Ich versuchte, meine Tränen zurückzuhalten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.