- Politik
- Wirtschaftskrise in Kuba
»Nur ein neues Dach wird nicht reichen«
Kuba sucht nach Lösungen, um die immer gravierender werdende Wirtschaftskrise zu überwinden

Der gesamte vordere Teil von Mario Leóns Haus in Havannas Innenstadt Centro Habana ist eine Baustelle. Der Eingangsbereich, der als Schreinerwerkstatt diente, und das angrenzende Wohnzimmer sind leer geräumt; überall liegen Baumaterialien herum: Säcke voller Zement und Sand, Eisenverstrebungen, Holzlatten, in einem umfunktionierten Wassertank wird Beton angemischt. León deutet nach oben. Rund zehn Meter über uns: ein auf einen Mittelbalken zulaufendes Satteldach aus Holz. An einigen Stellen dringen Sonnenstrahlen durch verrutschte oder kaputte Dachziegel. »Der Dachstuhl ist von Holzwürmern zerfressen«, sagt Mario. »Es regnet immer wieder herein. Ich lebe mit der ständigen Angst, dass das Dach zusammenbricht.«
Anfangs hat er bei jedem Regen Plastiktüten so aufgespannt, dass das Wasser in einen bestimmten Teil der Werkstatt tropfte und nicht auf seine Maschinen. Doch als mit jedem Regen mehr Wasser durch das Dach kam und dazu das Holz immer morscher wurde, hat sich León durchgerungen, ein Dach aus Beton zu bauen und eine Zwischendecke einzuziehen. Er habe mehrere Optionen durchgespielt, sagt León, die Betonvariante ist zwar die kostspieligste, aber auch die beständigste. Für die Zeit der Bauarbeiten hat der 62-Jährige die Küche zum Wohnzimmer umfunktioniert und ist mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern in den hinteren Teil des Hauses gezogen. Die Fundamente sind bereits gegossen; auch einige Betonpfeiler und Horizontalbalken stehen schon. Aber selbst ein Laie erkennt: Es liegt noch viel Arbeit vor Mario León.
Eigentlich heißt er anders, aber seinen richtigen Namen will León nicht in der Zeitung lesen. »Das bringt nur Probleme«, sagt er. Was für Probleme das sein könnten, sagt er nicht. Aber wenn man ihm Glauben schenken kann, hat er ohnehin schon genügend Sorgen. »Alles ist extrem teuer geworden«, sagt er. »Und über die Libreta gibt es kaum noch etwas.« Die libreta de abastecimiento ist eine Art Rationierungsheft, über das staatlich subventionierte Grundnahrungsmittel wie Reis, Bohnen, Speiseöl oder Hühnchen gleichmäßig an alle kubanischen Haushalte verteilt werden. Viele kubanische Familien sind darauf angewiesen.
»Diesen Monat gab es bislang drei Pfund Reis und zwei Pfund Rohrzucker. Das war’s«, erzählt León. Zwar hat er dafür nur 36 kubanische Pesos (CUP) bezahlen müssen, zum informellen Wechselkurs sind das umgerechnet 10 Euro-Cent. Aber die Menge reicht vorn und hinten nicht. Normalerweise gibt es sieben Pfund Reis – selbst das sei wenig –, »Kaffee gibt es seit Mai nicht mehr, Hühnchen schon noch viel länger nicht mehr«, sagt er; schwarze Bohnen oder Speiseöl auch nur sporadisch. Insgesamt ist das Warenangebot auf der Insel zwar besser als beispielsweise noch vor einem Jahr, weil die neuen kleinen und mittleren Privatunternehmen viele Lebensmittel importieren. Aber ein Pfund Reis im privaten Einzelhandel kostet schon mal 500 bis 1000 CUP, ein Kilo weißer Zucker 450 CUP – für die meisten Kubaner unerschwinglich. Die Regierung reagierte im Sommer mit Preisobergrenzen für Waren des täglichen Bedarfs, wie Hühnerfleisch, Speiseöl, Milchpulver, Wurstwaren, Nudeln und Waschmittel.
Für León sind jedoch selbst die gedeckelten Preise zu hoch. »Meine Familie verdient zusammen keine 14 000 Pesos im Monat«, sagt er. Leóns Tochter ist Augenärztin; der Sohn studierter Pharmazeut und Professor an der Universität Havanna. Beide verdienen knapp fünftausend Pesos im Monat; Leóns Frau als Putzkraft in einem staatlichen Unternehmen etwas weniger. »Wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben«, erzählt der 62-Jährige. »Wir haben keine Familie in den USA, die uns Geld überweist.« Er selbst verrichtet immer wieder Gelegenheitsjobs. Zuletzt hat er die Residenz eines Diplomaten eines afrikanischen Landes gestrichen. Den Lohn hat León fast komplett in den Kauf der Materialien für den Dachbau gesteckt. Immer, wenn etwas Geld hereinkommt, gehen die Bauarbeiten weiter.
In Leóns Viertel Centro Habana gibt es zahlreiche marode Gebäude. Kuba bleibt weit hinter seinen Plänen zum Wohnungsbau zurück, meldete kürzlich die Tageszeitung »Granma«. Bis Ende August hat die kubanische Regierung demnach nur 39 Prozent der für dieses Jahr geplanten 13 492 neuen Wohnungen fertiggestellt. Als Gründe werden unter anderem die »sehr niedrige Ausführungsrate« und die »unzureichende Materialproduktion in allen Bereichen« genannt. Wirtschaftsminister Joaquín Alonso Vázquez sagte vor wenigen Tagen gegenüber der Presse, dass Kuba wegen der US-Blockadepolitik seit mehr als 25 Jahren keinen Zugang zu Finanzierungen für den Bau und die Restaurierung der Wohnhäuser habe. Ökonomen verweisen aber auch darauf, dass sich die öffentlichen Investitionen in den vergangenen Jahren auf den Bau von Hotels konzentriert hätten, was zulasten anderer Bereiche ging.
Er habe in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Kilo abgenommen, sagt León. »Der Stress wegen der Versorgungslage und des Daches lässt mich nachts schlecht schlafen. Und dann auch noch der Hurrikan.« Ende Oktober, Anfang November suchten innerhalb weniger Tage zwei verheerende Wirbelstürme die Insel heim. Hurrikan Oscar sorgte im Osten Kubas für schwere Überschwemmungen, die mindestens acht Menschenleben kosteten und hohe Sachschäden verursachten. Anfang November dann wütete Wirbelsturm Rafael mit Hurrikanstärke 2 und Winden von bis zu 185 Kilometer pro Stunde im Westen der Insel. Allein in Havanna waren im Vorfeld fast 100 000 Menschen evakuiert worden. Der Zivilschutz funktioniert auf Kuba trotz aller sonstigen Schwierigkeiten immer noch ausgezeichnet.
Leóns Familie hat den Sturm zusammengepfercht in einem Zimmer im hinteren Teil des Hauses verbracht. »Wir haben uns Geschichten erzählt und gehofft, dass es schnell vorübergeht«, sagt León. »Ich bin alle zwei Minuten raus, habe mir einen roten Bauarbeiterhelm aufgesetzt und geschaut, ob alles in Ordnung ist.« Bis vier Uhr morgens sei er wach geblieben, erzählt er. »Zum Glück hat das Dach gehalten und es ist nur wenig Wasser in die Wohnung gelangt.«
Zuletzt erzeugte Kuba nur noch etwas mehr als die Hälfte des benötigten Stroms.
Vor allem in den Provinzen Artemisa, Mayabeque und Havanna verursachte der Sturm schwere Schäden in der Landwirtschaft, an mehr als 30 000 Gebäuden und in der Krankenhausinfrastruktur. Menschenleben waren zum Glück nicht zu beklagen. Hunderte Strommasten und Hochspannungsleitungen wurden aber beschädigt. Die Folge: ein mehrtägiger Stromausfall. Es war der zweite totale Blackout innerhalb weniger Wochen – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Mitte Oktober beim ersten landesweiten Stromausfall ging das wichtigste Kraftwerk des Landes, »Antonio Guiteras« in der Provinz Matanzas, »unvorhergesehen« vom Netz, woraufhin das Stromnetz der Insel komplett zusammenbrach und das öffentliche Leben mehrere Tage zum Erliegen kam. »Mehr als 70 Stunden waren wir ohne Strom«, sagt León. »Vielen Leuten ist das Essen verdorben, weil die Kühlschränke nicht mehr funktioniert haben.«
Stromausfälle nach Hurrikans sind angesichts der vielen Oberleitungen dagegen fast schon normal. León Familie hatte nach 36 Stunden wieder Strom, dafür aber acht Tage nach dem Sturm kein Wasser. Zahlreiche Wasserpumpen konnten wegen des Stromausfalls und der beschädigten Stromleitungen nicht arbeiten. »Wir haben Wasser in Kanistern von der Arbeitsstelle meiner Frau geholt«, erzählt León. »Der Betrieb ist zum Glück nur wenige Häuserblocks entfernt. Es war trotzdem eine ziemliche Schlepperei.«
Mittlerweile ist wieder eine gewisse Normalität eingekehrt. Normalität heißt in diesen Tagen: in Havanna gibt es rotierende Stromabschaltungen – jeden zweiten Tag, meist vormittags zwischen zehn und drei; manchmal zusätzlich nachmittags oder abends. Der staatliche Stromanbieter UNE informiert darüber in einem eigens eingerichteten Telegram-Kanal. In einigen Teilen des Landes ist der Strom sogar bis zu 20 Stunden am Tag weg. Zuletzt erzeugte Kuba nur noch etwas mehr als die Hälfte des benötigten Stroms. »Die Energie- und Wassersituation zermürbt die Leute«, sagt León.
Die kubanische Regierung sieht in der Verschärfung der US-Blockade die Hauptursache für die Energiekrise. 18 Tage ohne Blockade entsprechen den Kosten für die notwendige Instandhaltung der gesamten Stromversorgung des Landes, rechnete die Regierung kürzlich vor. In der Tat macht Kubas Listung als »Terror unterstützender Staat« durch Washington internationale Finanztransaktionen für das Land nahezu unmöglich, beispielsweise um bitter benötigte Brennstoffe zu erwerben. Ohnehin sind die Wärmekraftwerke aus Sowjetzeiten in die Jahre gekommen, und die Übertragungsleitungen anfällig, weil Investitionen in Wartung, Reparaturen und Modernisierungen fehlen. Zwar setzt die Regierung mittelfristig auf den Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch dafür sind Milliardeninvestitionen nötig – Geld, das Kuba angesichts von US-Sanktionen, ausbleibender Touristen und fehlender Exporte nicht hat. Eine schnelle Lösung wird es daher nicht geben.
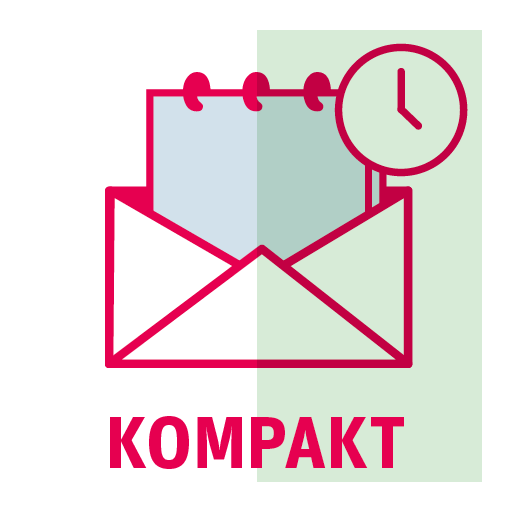
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
»Die Blockade besteht seit mehr als 60 Jahren«, sagt León. »Es stimmt, dass sie verschärft wurde und die Amerikaner versuchen, uns die Luft abzuschnüren, aber die Sanktionen werden auch in den kommenden Jahren nicht verschwinden, schon gar nicht unter Trump. Wir müssen also trotzdem Lösungen finden.« Vor allem viele junge Leute sind die Entbehrungen und den schwierigen Alltag zunehmend leid. »Mein Sohn ist Professor, meine Tochter Ärztin – beide sagen zu mir: Papa, ich kann nicht mit kaputten Schuhen oder immer in demselben Hemd vor meine Studenten oder Patienten treten«, sagt León. »Aber wie sollen sie sich bei einem Gehalt von umgerechnet 15 US-Dollar neue Kleidung kaufen?«
Seine Tochter, sagt er, würde – wie so viele junge Kubaner – lieber heute als morgen das Land verlassen und irgendwo anders ihr Glück suchen. Leóns Sohn schaut nach Stipendien für ein Masterstudium im Ausland. Die verheerende Wirtschafts-, Energie- und Versorgungskrise der letzten Jahre hat zu einer nie dagewesenen Ausreisewelle geführt. Mehr als zehn Prozent der kubanischen Bevölkerung haben in den vergangenen drei Jahren das Land verlassen. Und ein Ende des Exodus ist nicht in Sicht.
León kann seine Kinder verstehen, trotzdem hofft er, dass sie bleiben. Den Ausbau des Daches versteht er als Investition in die Zukunft. Aber er weiß auch: »Nur ein neues Dach wird nicht reichen, damit meine Kinder hierbleiben wollen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







