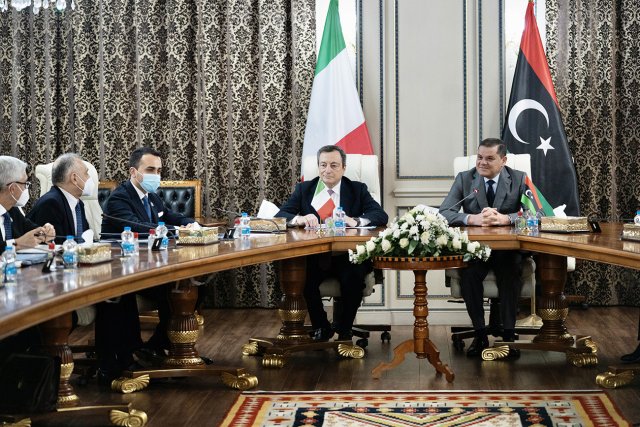- Politik
- Umweltverschmutzung
Paradies voller Plastik
Mit den Touristen kommt der Müll nach Sansibar. Der Unmut darüber wächst

Jaku Amer Issa sitzt in der Dorfschule von Jambiani, wo er früher unterrichtet hat. An der Mauer bröckelt die Farbe. Mit Mühe kann man neben dem Eingang zur Schule die schwarzen Buchstaben auf blauem Grund noch entziffern. »Environmental Awareness Campaign« steht dort. Direkt vor der Reklame für die Umweltkampagne liegen Plastikflaschen am Boden. Issa schaut zerknirscht unter seiner gold-weiß gemusterten Gebetsmütze hervor, wenn man ihn nach dem Abfall fragt. Der Müll vor der Mauer ist nicht sein einziges Problem.
Von der Schule führen sandige Wege durchs Dorf bis zur geteerten Hauptstraße. Dahinter ist Buschland. Dort, mitten in der Natur, liegen Haufen mit Plastikflaschen. Sie sind die Schattenseite des Geschäfts mit der Sonne.
Der Tourismus ist das Herz der Wirtschaft auf Sansibar. 640 000 Gäste sind 2023 hierher gereist. Das waren 16,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Gäste kommen aus Italien, Frankreich und Deutschland. Bis 2030 erwartet die Branche eine Million Besucher. Schon jetzt verursachen die Touristen 80 Prozent des Abfalls auf dem Inselarchipel. Dem Ferienparadies vor der Ostküste Afrikas droht ein Mülldesaster, wenn nichts passiert.
»Wir waren schon einmal weiter«, sagt Issa. Er hat befreundete Lehrer mit zum Interview gebracht. Sie erzählen begeistert von der früheren Aufklärungskampagne. »Jambiani war das Vorbild. Die Leute sind von weit her gekommen, um zu sehen, wie wir das Dorf sauber halten«, schwärmt Issa.
Er ist Mitgründer der Initiative Tuishi. 2004 gab das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 17 000 Euro. Damit baute Tuishi Latrinen im Dorf, sammelte den Müll vom Strand, holte den Abfall von Hotels ab, stellte Mülleimer für die Bevölkerung auf und erklärte Kindern und Erwachsenen, dass sie den Unrat zu den Sammelstellen bringen sollen.
Die Abfallhaufen verschwanden damals, und mit ihnen die Malaria. Die Moskitos fanden keine Brutstätten mehr in vergammelten Resten von Papayas, Bananen oder gebrauchten Windeln. Doch nach ein paar Jahren war das Budget des UNDP erschöpft. Die Lust, sich um den Abfall zu kümmern, schwand dahin. »Jetzt ist alles kaputt«, klagt Issa.
Das stimmt nicht ganz. Ein paar Meter von der Schule entfernt rattern die Nähmaschinen. Grace Uchana zieht einen alten Zementsack unter der Nadel durch. Bald wird daraus ein Rucksack entstehen. In einem Nebenraum liegen weitere gereinigte Säcke und Plastikflaschen, Bootsseile, Tetra-Tüten und zerschlissene Kitesegel. Uchanas Kollegen sammeln den Abfall vom Strand auf oder holen ihn bei den Hotels ab.
Dafür bezahlt ihre Chefin Sascha Borisowa gutes Geld, jedenfalls für lokale Verhältnisse. Die gebürtige Russin steigt über ein paar Stofffetzen und nimmt hinter der Nähmaschine Platz, wo Uchana gerade noch gearbeitet hat. Sie begrüßt alle Mitarbeiter mit Namen, es wird viel gelacht in der Nähstube. »Wir haben vier Müllsammler und sieben Schneider. Sie bekommen 150 bis 300 Dollar pro Monat«, erzählt Borisowa.
Die Angestellten verwandeln den Müll in Taschen, Hüte, Körbe oder Laptophüllen. Hip sehen die Sachen aus. Die Touristen kaufen sie gern in den Hotel-Shops oder auf Märkten. »So geht das Plastik zurück in die Industriestaaten und wird hoffentlich fachgerecht entsorgt«, sagt Borisowa und lacht.
Eine Studie des Centre for Science and Environment in Neu-Delhi beziffert die Menge Müll auf Sansibar mit 230 Tonnen – pro Tag. Nur 120 Tonnen werden von der Müllabfuhr abgeholt. Die meisten Leute verbrennen oder vergraben ihren Abfall, manche schmeißen ihn ins Meer oder in den Busch. Die Studie stammt aus dem Jahr 2016. Inzwischen ist der Abfallberg gewiss gewachsen.
Der Müllberg mag gigantisch sein, Borisowas Optimismus ist es auch. »Klar verarbeiten wir nur ein paar Tausend Tetrapacks und Plastikflaschen pro Monat, aber wir bringen den Leuten bei, dass Müll einen Wert hat und dass sie ihn nicht in die Landschaft kippen sollen«, sagt sie. Immer mehr Dorfbewohner brächten Plastikflaschen und Flipflops, Reis- und Zementsäcke zur Nähstube, erzählt Borisowa. Schließlich bekommen sie ein paar Cent dafür.
Das Klein-Klein reicht aber nicht, um die drohende Katastrophe zu verhindern. »Wir bräuchten vier Deponien und systematisches Recycling«, sagt Suleiman Mohammed, Präsident der Vereinigung der Tourismus-Investoren auf Sansibar. Auf der Hauptinsel Unguja gibt es nur eine einzige offizielle Müllhalde. Sie liegt 20 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Sansibar-City. Die Deponie in Kibele ist mit 47 Hektar viel zu klein angesichts der steigenden Müllmenge. Kaum etwas wird wieder verwertet.
Es muss etwas geschehen. Denn Sansibar zieht nicht nur Touristen an. Es leben auch mehr Menschen auf der Insel. Die Bevölkerung wächst von Jahr zu Jahr um drei Prozent. Mehr Menschen bedeutet mehr importiere Plastikprodukte und immer mehr Abfall. Denn die Einheimischen nehmen die Lebensgewohnheiten aus den Industriestaaten an, zumal immer mehr Menschen aus den Ländern des Nordens auf die Insel im Süden ziehen.

Viele Ausländer haben Sansibar während der Corona-Pandemie entdeckt. Tansania und das halb autonome Sansibar hatten den Menschen damals fast alle Freiheiten gelassen. So wurde das Ferienparadies zum Eldorado für »Lockdown-Flüchtlinge«, und mancher ist dort hängengeblieben.
Auch bei Tansaniern vom Festland wird Sansibar immer beliebter. Sie hoffen auf Arbeit in einem der 700 Hotels oder Restaurants. Dabei ist Sansibar keineswegs reich, trotz Tourismus, Fischerei und Gewürzhandel. Ein Viertel der 1,9 Millionen Sansibari lebt in Armut. Der Müll könnte sie noch weiter in den Abgrund stoßen – und den Investoren das Geschäft verderben. 86 Prozent des Mülls auf Sansibar sind zwar organisch. Aber am Strand und im Meer ist Plastik schon jetzt das größte Problem.
Die Weltbank schätzte schon für 2019, dass die Plastikverschmutzung die Wirtschaft Sansibars um 17,6 Millionen Dollar geschädigt hatte. Das waren 1,3 Prozent des Bruttosozialprodukts. Der Plastikmüll trifft den Tourismus laut Weltbank besonders hart – ausgerechnet die Branche also, die 80 Prozent der Devisen und fast ein Drittel des Bruttosozialprodukts beisteuert.
Die Regierung Sansibars ist alarmiert. Sie hat längst Gesetze erlassen, die Müllsünder bestrafen, wenn sie den Abfall in den Busch, ins Meer oder sonst wohin schmeißen. Hotels sind verpflichtet, Verträge mit der Müllabfuhr zu schließen. Die Regierung betreibt seit einiger Zeit auch Kampagnen für ein »grünes Sansibar«. Bis 2030 will sie das Archipel zur Top-Destination für nachhaltige Wirtschaft machen.
Die Crux ist allerdings, dass nicht alle mitziehen. Um die Müllabfuhr kümmern sich private Firmen. Manche Müllmänner schmeißen den Abfall dann selbst in den Busch, statt ihn nach Kibele zu fahren. Solange sie nicht erwischt werden, haben sie nichts zu befürchten.
Und selbst manche Hotels halten das so. Die Manager drücken einem Fahrer 10 oder 20 Dollar in die Hand, damit er ihnen den Abfall vom Hals schafft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und das, obwohl viele Hotelbetreiber aus westlichen Ländern stammen, wo man weiß, welche Schäden für Umwelt und Gesundheit Mülldumping anrichtet.
Investoren-Chef Mohammed treibt das den Zorn ins Gesicht. »Das ist reine Profitgier«, schimpft er. Der 53 Jahre alte Sansibari sitzt in der Cafeteria seiner Firma Chako außerhalb der Hauptstadt Sansibar-City. Dort hängen Lampen, die seine Mitarbeiterinnen aus Glasflaschen hergestellt haben. Am Eingang der Produktionshalle hat er aufmalen lassen, wie viele Flaschen pro Jahr Chako zu Lampen, Trinkgläsern, Aschenbechern, Kerzenständern oder Aufbewahrungsdosen verarbeitet. Es sind 1,3 Millionen.
Die Arbeit erfordert Geduld. Frauen mit Kopftüchern sitzen nebeneinander an einem Tisch. Jede von ihnen dreht langsam eine Flasche über einer Kerze, solange, bis das Glas warm genug ist, dass man die Flasche auseinanderbrechen und die Teile weiter verarbeiten kann. Nebenan schreddert eine Kollegin Plastik in einer Maschine. Daraus werden einmal Tischplatten.
Chako exportiert auch nach Europa. Dekor-Geschäfte in Deutschland sind die größten Abnehmer. Die Firma wird über drei Jahre mit 240 000 Euro von der Tui-Stiftung gefördert.
Immer mehr Tourismusbetriebe erkennen, dass sie Müll reduzieren und wieder verwerten müssen, wenn sie ihr Geschäft auf Sansibar erhalten wollen. Manche Hotelmanager kaufen Land, wo sie den organischen Abfall kompostieren. Mit dem Kompost wollen sie Gärten und Gemüsefelder düngen. Andere stellen Jugendliche an, damit sie den Müll am Strand aufsammeln.
Mohamed Omari ist einer, der die Weichen für Sansibars Zukunft stellt. Um ihn zu treffen, muss man eine steile Steintreppe in einem der alten Häuser in Sansibar-City erklimmen. Der 26-Jährige lehrt im Kawa-Trainingszentrum. Studierende in blauen T-Shirts mit dem Logo der Schule erfahren von Omari, wie nachhaltiger Tourismus geht. »Das schlechte Abfallmanagement ist die größte Tragödie Sansibars«, klagt Omari.
Für den Lehrer ist klar: »Wir müssen aufklären, aufklären, aufklären«. Viele Leute in Sansibar würden die Folgen für die Umwelt und die Gesundheit völlig ausblenden. »Das gilt auch für Hotelmanager und ihre Angestellten«, ärgert sich Omari. Er gibt Kurse in Tourismusbetrieben, und natürlich bringt er den Kawa-Studierenden bei, wie sie später, wenn sie als Kellner, Managerinnen, Köche oder Serviererinnen arbeiten, Abfall vermeiden oder fachgerecht entsorgen können.
Omari klettert im Kawa-Zentrum noch eine Etage höher. Dort kann er ungestört reden. Immer mehr Einheimische würden wütend darüber, dass die Fremden so viel Dreck verursachen, erzählt er. Und Omari warnt: »Wir müssen schnell handeln, sonst gibt es Krieg zwischen den Dorfbewohnern und den Hotels«. Und der wäre Gift für das Ferienparadies.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.