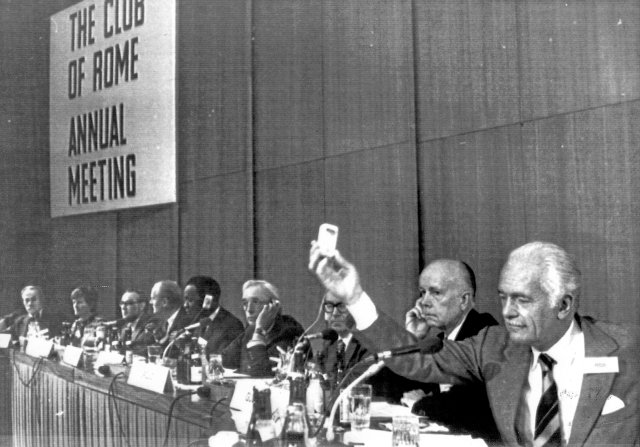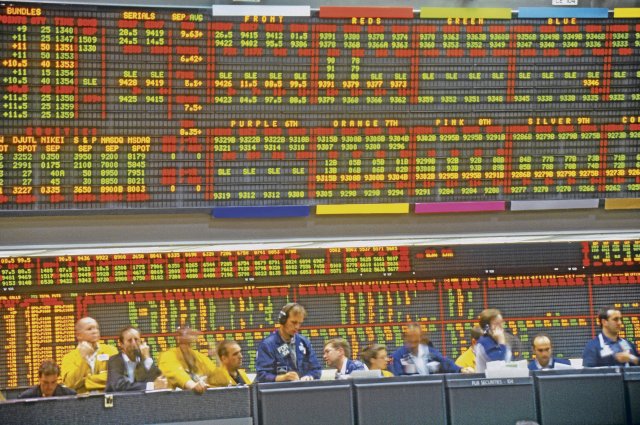Mehr Zeit und offene Türen
Psychiatriekongress konstatiert lückenhafte Versorgung
Neben Fragen von Diagnostik und Therapie debattieren Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) die Versorgung seelisch Kranker in Deutschland. Jürgen Fritze, gesundheitspolitischer Sprecher des Berufsverbandes, beklagte, es seien zu wenig Verträge der Integrierten Versorgung abgeschlossen: Für eine optimale Behandlung müssten Hausarzt, Psychiater, Psychotherapeut, Krankenpfleger, Ergo- und Physiotherapeuten sowie Sozialarbeiter zusammenwirken. Traditionell seien jedoch Hausärzte die ersten Ansprechpartner und blieben dies bei 20 Prozent der psychisch Kranken dauerhaft. Allgemeinmediziner seien dafür in der Regel jedoch nicht ausreichend ausgebildet. Besonders viele Fachkräfte fehlten in Ostdeutschland und auf dem Land.
Auf dem Kongress kamen auch Vertreter von Patienten und Angehörigen zu Wort. Ruth Fricke vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener (BPE e.V.) kritisierte die unexakten Definitionen von Selbst- und Fremdgefährdung in den Gesetzen: »Niemand käme auf die Idee, einen Diabetiker, der seine Medikamente nicht nimmt oder seine Diät nicht einhält, zwangseinzuweisen.« Dabei wirke dieser sowohl fremd- als auch selbstgefährdend, wenn er zum Beispiel als Kraftfahrer ins Zuckerkoma fiele. Sie forderte bessere ambulante Hilfen, um Klinikeinweisungen möglichst zu vermeiden. Fricke verwies auf ein Konzept der Westfälischen Klinik Gütersloh. Es ermögliche mit Wohnküche als Kommunikationsmittelpunkt, einem Ruhe- und Schutzraum sowie einem Bezugspersonensystem eine Psychiatrie der offenen Tür. Zwangseinweisungen und -maßnahmen seien so drastisch gesenkt worden.
Laut Karl-Heinz Beine, Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Hamm, steigt mit sinkender Sozialkompetenz die Wahrscheinlichkeit, dass ein psychisch Kranker nötige Hilfe nicht erhält. Dies widerspreche dem ständig wiederholten Postulat, die Psychiatrie müsse »vom Menschen aus« gedacht werden. Er hoffe, dass mit dem neuen, tagesbezogenen Entgeltsystem in der stationären Psychiatrie ab 2013 den Bedürfnissen der Patienten wieder mehr Rechnung getragen werde. Nicht umsonst arbeite man im Gegensatz zu allen anderen Disziplinen nicht mit diagnosebezogenen Gruppen, da hier die Schwere der Krankheit und ihre Dauer sowie der Grad der Chronifizierung über den Behandlungsaufwand entschieden.
Auch Iris Hauth, ärztliche Direktorin einer Berliner Klinik, orientiert auf bessere Integration von Krankenhaus- und ambulanter Behandlung. Die therapeutischen Wirkfaktoren Zeit und Beziehung sollten durch das neue Entgeltsystem mehr Gewicht erhalten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.