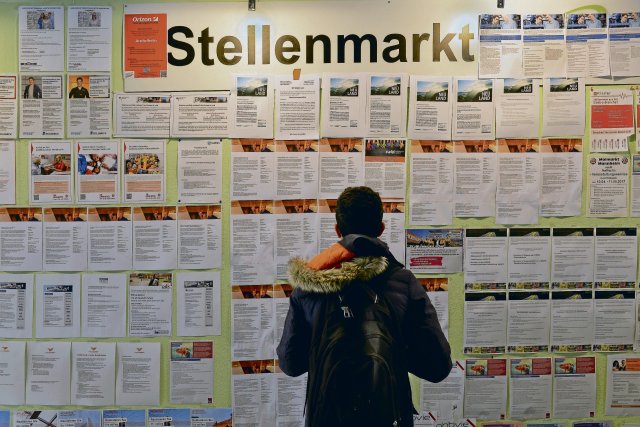- Politik
- Kulturbeitrag
Chic aus Bonn und Ostberlin
In Erfurt gibt die Ausstellung »Zwei Welten – zwei Moden?« Einblick in Kleiderschränke von früher
Erfurt. Ob grober Strick, feine Seide oder schwerer Samt: Nostalgisch aufgereiht hängen die Ausgeh-Roben früherer Jahre auf Kleiderbügeln nebeneinander. Den edlen wie farbenfrohen Abend- und Cocktailkleidern, Kostümen und Hosenanzügen ist ihre Herkunft kaum anzusehen.
»Die Ost-Frau war vom Kleidungsstil nicht groß von der West-Frau zu unterscheiden«, meint Marina Moritz, Direktorin des Museums für Thüringer Volkskunde in Erfurt. Ihr Haus begibt sich ab heute mit der Ausstellung »Chic aus Bonn und Ostberlin. Zwei Welten – Zwei Moden?« auf einen vergnüglichen Streifzug durch vier Mode-Jahrzehnte. Bis zum 29. August können Besucher der Schau rätseln, ob die Garderobe samt Accessoires wie Hüte, Taschen und Schuhe einst Trägerinnen im Osten oder Westen zierte. »Was im geteilten Deutschland en vogue war, das gaben die Trends aus Paris vor«, sagt Moritz. Allerdings waren diese im Westen schneller und unendlich leichter umzusetzen. »Der große Unterschied bestand in der Beschaffung«, sagt Moritz. Wer im Osten nicht auf Westpakete hoffen konnte und wem das nötige Geld für die teuren Exquisit-Läden fehlte, der brauchte eine Nähmaschine und Improvisationstalent.
»Mode war ebenfalls Mittel der Systemauseinandersetzung – beide Staaten haben versucht, damit Politik zu machen«, erklärt die Museumschefin. In den Wirtschaftswunderjahren der BRD trugen schicke Sachen zum neuen Selbstbewusstsein gegenüber den Schwestern im Osten bei. Auch der Arbeiter-und-Bauern-Staat hatte ein Interesse, das schöne Antlitz des Sozialismus zu zeigen – scheiterte aber im modischen Wettstreit am mit den Jahren immer krasser werdenden Mangel an allem. Die Entwürfe der Gestalterkollektive des zentralen Modeinstituts fielen meist den ökonomischen Zwängen der real existierenden Planwirtschaft zum Opfer. So wurde die aufkommende Maxi-Mode mit einem größeren Stoffverbrauch zum Problem. Oder man verzichtete auf Doppelnähte.
»Wir waren eine reine Alibi-Institution, die keine Mode verkaufen konnte«, erinnert sich die heutige Trendforscherin und frühere Designerin Elke Giese, die lange Jahre am Modeinstitut der DDR arbeitete. Die Bekleidungsindustrie habe vorrangig zur Devisenbeschaffung für westdeutsche Versand- und Kaufhäuser produziert. »Mode war in der DDR ein absoluter Mangel«, sagt Giese. Wenn Frau sich kleiden wollte wie im Westen, musste sie zu einer Schneiderin gehen – oder sie nähte und färbte selbst.
»Das modische Schritthalten war ein mühevolles Unterfangen«, pflichtet Museumschefin Moritz bei. »Dennoch sind die Frauen im Osten nicht als graue Mäuse herumgelaufen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.