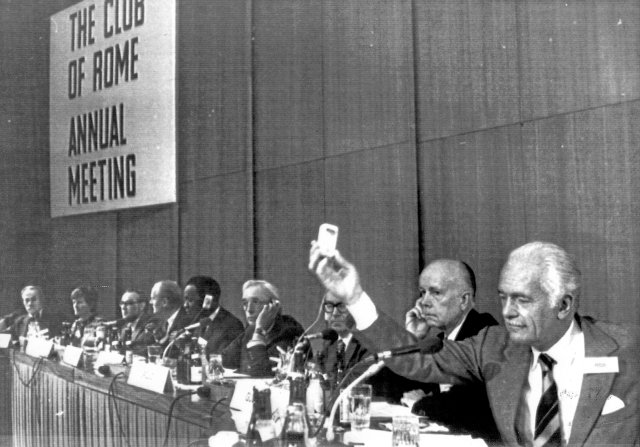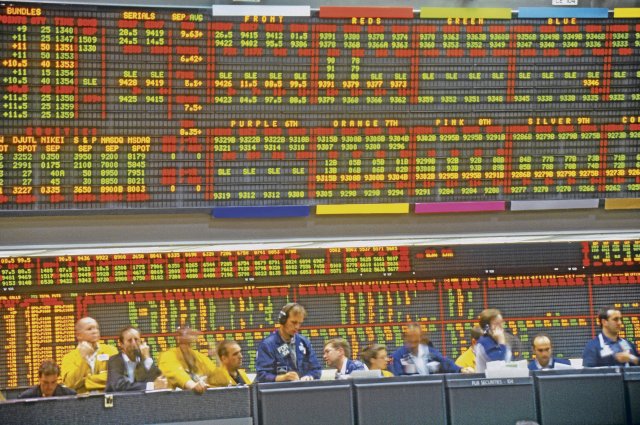Schweden sehen Wald vor lauter Bäumen doch
Neues Forstgesetz strebt eine „grüne“ Wende und „nachhaltige“ Waldbewirtschaftung an (Teil 1) Von Dr. ROLF GÜNTHER
Große Kahlschläge (Bild oben) wird es in Schwedens Wäldern nicht mehr geben. Dagegen soll nun das Holz selektiv „geerntet“ werden (unten) Fotos: MoDo
Fährt man heute quer durch Südschwedens grünes Meer der Wälder, kann man sich kaum vorstellen, daß sich hier vor über hundert Jahren eine fast baumlose Heide erstreckte. Schweden erlebte damals eine Bevölkerungsexplosion, die den Ur-Wald buchstäblich aufzehrte. Ende des 19 Jahrhunderts machte in verschiedenen Gebieten extremer Mangel an Bau- und Feuerholz das Leben unlebbar - mit ein Grund für einen Exodus, der die Einwohnerzahl um ein Drittel reduzierte. 1903 beschloß der schwedische Reichstag das erste und seinerzeit strengste Forstgesetz der Welt: Wer einen Baum fällt, muß einen neuen pflanzen. Hunderttausende Hektar Heide wurden in der Folge in Südund Mittelschweden wiederbewaldet. Unter strikter staatlicher Regulierung hat man seitdem fast das ganze grüne Meer rational bewirtschaftet.
Diese frühe Wende von ausbeutender zu „nachhaltiger“ Forstwirtschaft machte sich bezahlt: Schweden hatte noch nie so viel Wald wie heute. Die Forste bedecken derzeit sechs Zehntel der Landesfläche und beherbergen 2,6 Milliarden Kubikmeter Holz (112 Kubikmeter je Hektar). Jährlich wachsen 95 Millionen Kubikmeter nach. In den letzten Jahren wurden jeweils nur 65 Millionen entnommen, ein Drittel des Zuwachses geht aufs Haben-Konto. Das Guthaben besitzt auch ökologischen Wert. Als Teil des weltweit vernetzten Ökosystems absorbiert der Wald 25 Millionen Tonnen Kohlenstoff mehr als Schweden durch Verbrennung fossiler Stoffe freisetzt.
Trotzdem ist man in Schweden nicht zufrieden. Das Hauptproblem formulieren die Schweden - wie wir in Gesprächen mit Forstleuten, Wissenschaftlern und Naturschützern hörten- so: Die alte Forstpolitik machte den Forst reicher an Holz, aber ärmer an Leben. Es gibt mehr Bäume denn je, aber nicht mehr Wald.
Weil sie ihn vorrangig der Faserstoff„produktion“ anpaßte, hat die intensive Bewirtschaftung den Forst immer weiter vom Naturwald entfernt. Kaum 5 Prozent des Walds existieren noch unberührt, alles andere sind, grob gesagt, Plantagen für eine landesweite Monokultur langfaseriger Nadelhölzer - zu 85 Prozent Fichten und Kiefern -, in denen Laubbäume oft wie Unkraut gejätet wurden. Auch die Über-Hundert-Jährigen - ein weiteres Merkmal der Urforste - sind rar. Im Alter von 70 bis 90 geht auf den Plantagen ein Baumleben zu Ende. Zugleich säuberte man den Wirt-
schaftswald penibel von jedem toten und umgebrochenen Stamm, im natürlichen Wald besteht rund ein Drittel des Holzes aus toten, sich zersetzenden Bäumen. All diese „rationalen“ Eingriffe reduzierten, ja vernichteten Lebensräume von (nichtproduktiven) Pflanzen und Tieren.
Seit Beginn 1994 gilt nun ein neues Forstgesetz in Schweden, apostrophiert als eine „grüne“ Wende. „Nachhaltige“ Forstwirtschaft heißt nun nicht mehr nur Reproduktionspflicht für den Rohstoff Holz, sondern auch für das Biosystem Wald. Quintessenz des gesetzlich fixierten neuen Waldbaukonzepts Schwedens: Hohe Produktion wertvollen Holzes und Bewahrung der biologischen Vielfalt haben gleiche Priorität. Das neue Gesetz verzichtet weitgehend auf frühere zwin-
gende Regeln, überträgt dem Forstbesitzer - Eigentum verpflichtet - die Verantwortung für die arterhaltende Waldpflege. Dazu gibt es drei „Postulate“-
1. Im künftigen Schwedenwald müssen alle bisher natürlich vorkommenden Pflanzen- und Tierarten in ausreichender Anzahl überleben können. Dazu werden generell Gebiete von hohem Naturwert (auch solche mit alten Kulturspuren), wo wertvolle und bedrohte Moose, Flechten, Pilze, Insekten, Vögel etc. existieren, von jeglicher Nutzung ausgenommen, indem man weitere Reservate einrichtet, die in den Nutzforsten versprengten kleinen „Schlüsselbiotope“ - Felsränder, Schluchten u.a. - zusammenfaßt. Derzeit stehen 2,8 Prozent des Waldes unter Schutz - viel zu wenig, vor al-
lem im Süden, sagen die Naturschützer.
2. Die der Holzproduktion dienende Forstarbeit wird verstärkt mit Methoden verbunden, die ökologische Erfordernisse berücksichtigen. Dazu gehört vor allem die Ersetzung, bzw. sehr differenzierte Anwendung des Kahlschlags. Immer wieder beteuerten unsere Gesprächspartner, daß die Zeit der großen Kahlschläge - erschreckende Bilder für die Naturfreunde - in Schweden endgültig vorbei sei. In den 60er und 70er Jahren wurden im Landesnorden Areale von 70 bis 80 Hektar (jährlich 200 000 ha) auf einen Hieb leergemacht.
Auf die Greenpeace-Kampagne „Kahlschlagfreies Papier“ - ein indirekter Boykottaufruf gegen Anwender dieser Forst-
methode, der sich auch deutsche Verleger angeschlossen haben - reagieren die Schweden gelassen. Denn der moderne Kahlschlag, der sowieso nur von den Großunternehmen und nur im Norden benutzt
wird, umfasse heute jeweils höchstens 10 bis 20 Hektar, und die Hiebflächen seien danach .alles andere als kahl“
Gerade an den neuen Holzeinschlagmethoden dürfte die „Wende“ im schwedischen Wald zu messen sein: Einzelne oder Gruppen alter Bäume und andere wertvolle Elemente (bis 10/ha) sind zu verschonen, einige davon sollen ihr Leben ausleben, umstürzen und vermodern. Auch Dürrständer und faulende Baumstümpfe beläßt der moderne Endhieb. Die Stehen- und Liegenbleiber geben den bestandstypischen Arten einen Stützpunkt, von dem aus sie den verjüngten Forst neu erobern können. „Lassen wir eine Espe stehen, bekommen wir später 165 Arten von Lebewesen, noch Birken dazu, lebend oder tot, und wir erhalten weitere 300 Arten“, rechnete uns Forstmeister Tomas Gustafson vom Forstaufsichtsamt Jönköping vor. Immer wichtiger nehme man auch den selektiven Einschlag, wobei bis ein Drittel der Bäume stehen bleibt. Sie besamen dann die Freifläche und beschirmen die Jungpflanzen gegen Sommerfröste. So gewinne die natürliche Regeneration, die dem Wald Vielfalt zurückgibt, gegenüber der dominierenden Anpflanzung wieder Raum.
3. Der Schwedenforst von übermorgen soll wieder - mindestens zu 10 Prozent - von Laubbäumen durchmischt sein, die auch alt werden dürfen. Die stigmatisierte Birke ist rehabilitiert. Und last not least: Herbizide werden - im Gegensatz zu Deutschland - im schwedischen Wirtschaftsforst generell nicht'mehr eingesetzt, einige Ausnahmegenehmigungen laufen bis 1996 aus.
(Die praktische Umsetzung des neuen Forstkonzepts wird in einem 2. Beitrag behandelt, der voraussichtlich in einer Woche erscheint)
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.