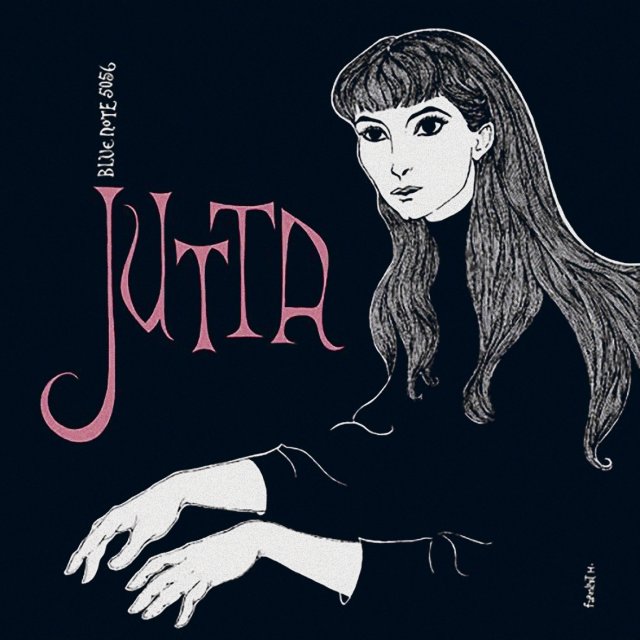- Kultur
- Zum 100. Geburtstag von Boris Pilnjak
.Ehrlich mit mir und Rußland'
KiiKInnri“ Von KARLHEINZ KASPER
Der Sohn des Wolgadeutschen Tierarztes Wogau, der sich als Schriftsteller Pilnjak nannte, war durch sein Elternhaus von den Wertvorstellungen der Volkstümlerintelligenz geprägt. Dazu gehörte auch die Überzeugung, dem Volk, das jahrhundertelang hatte Opfer bringen müssen, verpflichtet zu sein, die Schuld abzutragen und ihm selbstlos zu dienen. „Ehrlich mit mir und Rußland“ -diese Worte machte Pilnjak zu seiner Devise. Er war keijp Kommunist. In der Herrschan der Bolschewiki sah er jedoch den Ausdruck eines historischen Willens, der sein Land auf den Weg zurückführen sollte, der mit der Orientierung auf Europa durch Peter I. aufgegeben worden war. Die Revolution von 1917 besitze in erster Linie nationale Bedeutung und habe eine bäuerliche Periode in Rußlands Geschichte eingeleitet, erklärte Pilnjak bei seinem Berlinaufenthalt 1922.
„Rußland. Revolution.
Schneesturm.“ Das 7 Kapitel des Romans „Das nackte Jahr“ (1922) besteht nur aus diesen drei Worten. Rußland - für Pilnjak sind das heruntergewirtschaftete Gutshäuser, weltabgeschiedene Dörfer mit seltsamen Namen wie Stary Kurdjum, Provinzstädte mit zahllosen Kirchen, Kaufhöfen, Jahrmärkten, Feuersbrünsten und sporadischen Ausbrüchen
sinnlicher Leidenschaft. Und das alles liegt irgendwo zwischen Europa und Asien. Revolution machen hier landhungrige Bauern, asketische „Lederjacken“ und Anarchisten, den Kopf voller Märchen und Illusionen. Der Schneesturm aber überdeckt alles in diesem Land, nicht zuletzt die spontanen, rauschhaften Aktionen, die vieles durcheinanderwirbeln, doch an der Lebensweise der Menschen kaum etwas ändern. * - ?< >.
Pilnjaks Prosa hat ihre Würzein im Schaffen Bunins, Hamsuns und Belys. Vor allem das Frühwerk zehrt von der realistischen Erzählkunst Bunins und übernimmt Hamsuns Faszination durch die Mysterien von Zeugung, Geburt und Tod. Pilnjaks Tiergeschichte „Ein ganzes Leben“ (1916) und die Fürsten-und-Bauern-Saga „Tausend Jahre“ (1919) wollen auf Analogien im ewigen Stirb und Werde aufmerksam machen. Liebe als Sexualität und Tod als Rückkehr in den natürlichen Kreislauf bleiben auch weiterhin Grundmotive im Werk des Schriftstellers. Belys Roman „Petersburg“ wird für ihn durch sein Rußlandbild, den ornamentalen Stil und den freien Umgang mit dem Text wegweisend. In den konstruktiven Romanen „Das nackte Jahr“ und „Maschinen und Wölfe“ (1925) entwickelt Pilnjak, zeitgleich mit Samjatin
und Joyce, das Kompositionsprinzip der Montage. Zu diesem Zeitpunkt ist er einer der produktivsten und einflußreichsten Autoren Rußlands. Als sich ihm auch einige der Petrograder „Serapionsbrüder“ zuwenden, beginnt Gorki, um seine Schützlinge fester an sich zu binden, aus dem Ausland einen Feldzug gegen die „Moskauer Schule“ Pilnjaks. Der ist inzwischen auch in das Kreuzfeuer tter-offiziellen« Kri* tik geraten, nachdem Trotzki Üen „BlickwmköP der Dörfer und Provinzstädte“ in seinen Romanen und Erzählungen verwarf und erklärte, Pilnjak sei kein „Künstler der Revolution“, sondern nur ihr „Mitläufer“
Nach dem Bekanntwerden der „Geschichte vom nichtausgelöschten Mond“ (1926), durch die Stalin sich angegriffen fühlte, rissen die Auseinandersetzungen um Pilnjak nicht mehr ab. 1928 zum Vorsitzenden der Moskauer Schriftstellersektion gewählt, mußte er das Amt ein Jahr später niederlegen. Eine gemeinsam mit Platonow verfaßte kritische Reportage über die Gebiets- und Verwaltungsreform, eine skeptische Äußerung über den „gesellschaftlichen Auftrag“ und die Veröffentlichung der Erzählung „Mahagoni“ in Berlin boten Anlaß, Pilnjak „Kumpanei mit der weißen Emigration“ und „Verrat an
den Interessen der Arbeiterklasse und Revolution“ vorzuwerfen. Im Gegensatz zu Samjatin und Bulgakow, die aus ihrer oppositionellen Einstellung kein Hehl machten, suchte Pilnjak seine Loyalität unter Beweis zu stellen. Er fügte eine veränderte Version von „Mahagoni“ in den Roman „Die Wolga fällt ins Kaspische Meer“ (1930) ein. Karl Radek, kurz zuvor selber als Anhänger der : „trotzkistischen . Opposition“ angeklagt, versicherte dem Autor, daß er'mit“3iesefn Fünfjahrplanroman auf dem rechten Weg wäre.
Boris Pilnjak besaß den Mut, sich 1935 bei Stalin für die Freilassung des Sohnes von Anna Achmatowa einzusetzen. Doch gerade Mut und Ehrlichkeit kompromittierten ihn in den Augen der Machthaber. Am 21. April 1938 wurde Pilnjak als „Trotzkist, japanischer Spion und Vaterlandsverräter“ erschossen. Seine großen Romane „Die Doppelgänger“ und „Der Salzspeicher“, die letzten Erzählungen sowie Briefe und Statements erreichen den Leser erst heute.
Zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse legte der Suhrkamp Verlag Briefe und Dokumente von Boris Pilnjak unter dem Titel „...ehrlich sein mit mir und Rußland“ vor, herausgegeben und übersetzt von Dagmar Kassek.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.