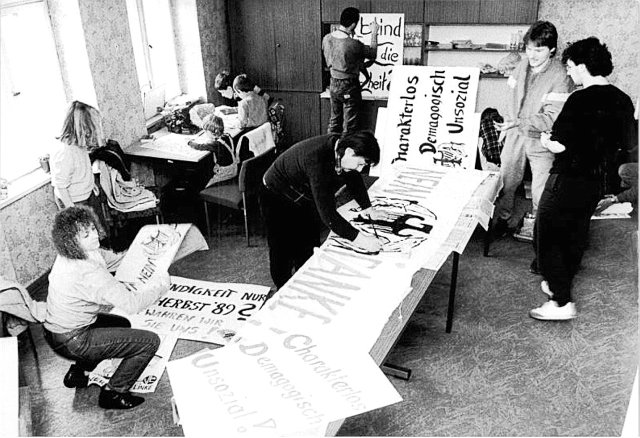- Kultur
- Vor 50 Jahren wurde Albrecht Haushofer ermordet
Testament: Moabiter Sonette
Die Rote Armee stand schon in den Berliner Vorstädten; ate' Albrecht Haushofer, zusammen mit anderen Häftlingen,' den Schergen der Durchhaltejustiz zum Opfer fiel. Zwei Wochen noch, und das barbarische Regime war am Ende. Aber das Bündel Gedichte, das man bei ihm fand, war nun ein Testament, im Titel für die Nachwelt eingeschrieben der Name des Orts seiner letzten Leidenstage: „Moabiter Sonette“
Der Vater des Toten war der Geopolitiker Karl Haushofer, dessen verhängnisvolle Ideen auf Adolf Hitler nicht ohne Einfluß gewesen sind. Sein Sohn aber hatte früh das Unheil gespürt, das damit heraufzog. 1903 in München geboren, schlug er zwar dieselbe wissenschaftliche Laufbahn ein wie sein Vater, zog aus seinen Erkenntnissen jedoch entgegengesetzte Schlußfolgerungen. Er nutzte seine Karriere - 1930 Dozent an der Berliner Hochschule für Politik und 1940 Professor für Geographie -, um die ihn immer mehr bedrängenden Bedenken gegenüber der deutschen Politik, wo immer möglich, vorzutragen. Zeitweilig hatte er sogar das Ohr Ribbentrops, dem dieser Warner aber bald unbequem wurde. Den Beraterstuhl beim Auswärtigen Amt vertauschte er erstmals mit dem Gefängnis, als Rudolf Heß 1941 seinen geheimnisumwitterten Flug nach England unternommen hatte. Verbindungen mit den Verschwörern des 20. Juli, unter anderem mit Popitz und von
der Schulenburg, führten im Dezember 1944 zur-erneuten Haft, d^r die Hinrichtung so kurz vor dem Ende des Krieges folgte.
Die Sonette spiegeln diesen Weg, insbesondere die letzte Strecke. Als Lyriker hatte sich Haushofer schon früher versucht, bevor er in Dramen römische Geschichte thematisierte („Sulla“ 1938, „Augustus“ 1939) und darin eine versteckte Zeitkritik betrieb. Der rhetorische Gestus dieser Werke und das Element der Verschlüsselung bleiben auch in den Sonetten spürbar und sind diesem Genre ja auch nicht fremd. Resignation und Zuversicht, Furcht und mutiger Protest, Liebe und Verachtung kommen in der Antithetik des Sonetts zum Tragen. Im Humanum der strengen Form, ihrer Bewältigung, behauptet er sich gegenüber der Drangsal, der er in seiner Todeszelle ausgesetzt ist; zum Teil schreibt er diese Verse mit Fesseln an den Händen.
Haushofer empfindet sich in den Sonetten als „Kassandro“, der „die ganze Todesnot von Volk und Reich/ durch bittre Jahre schon vorausgekannt“ Hitler ist ihm die „Inkarnation des Bösen“, ein neuer Rattenfänger von Hameln. Im Schein der olympischen Flamme von 1936 bereits sieht er den „grauenhaftesten der Kriege“ mit seinen Feuerzeichen aufleuchten. Geschichtliche Gestalten wie Sokrates und Thomas Morus sind ihm ebenso Leitbilder wie seine dem Wohl der Menschen dienenden Zeit-
genossen Fridtjof Nansen und Albert Schweitzer.!'In der-'Per* son des spätrömischen Philosophen Boethius, der sein letztes zukunftsweisendes Werk über „Der Weisheit Trost“ vor seiner Ermordung in der Gefangenschaft geschrieben hatte, versinnbildlicht Haushofer sein eigenes Schicksal und die selbst gestellte Aufgabe.
Inspiriert ist seine Dichtung wie seine antifaschistische Haltung vom Geiste des Christentums. Dennoch ist der Begriff der „Schuld“ in dem Sonett dieses Titels weniger in einem religiösen Sinne zu verstehen,
wenn es darin heißt: ..... Doch
schuldig bin ich anders als ihr denkt,/ ich mußte früher meine Pflicht erkennen,/ ich mußte schärfer Unheil Unheil nennen -/mein Urteil hab ich viel zu lang gelenkt.../ ich kannte früh des Jammers ganze Bahn -/ ich hab gewarnt - nicht hart genug und klar!/ Und heute weiß ich, was ich schuldig war...“
Aus diesem „zu spät“ resultiert wohl die Todesgewißheit in vielen der 80 Sonette, besonders dem letzten. Dennoch waren und bleiben sie ein literarisches Monument christlicher Gewissensprüfung und antifaschistischen Verantwortungsbewußtseins, in diesen Tagen intensiven Nachdenkens über jene Zeit sich einordnend in die Reihe der nun ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Vorgänge, Schwüre und Zeugnisse, die immer erinnerungswürdig sein werden.
HORST H. LEHMANN
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.