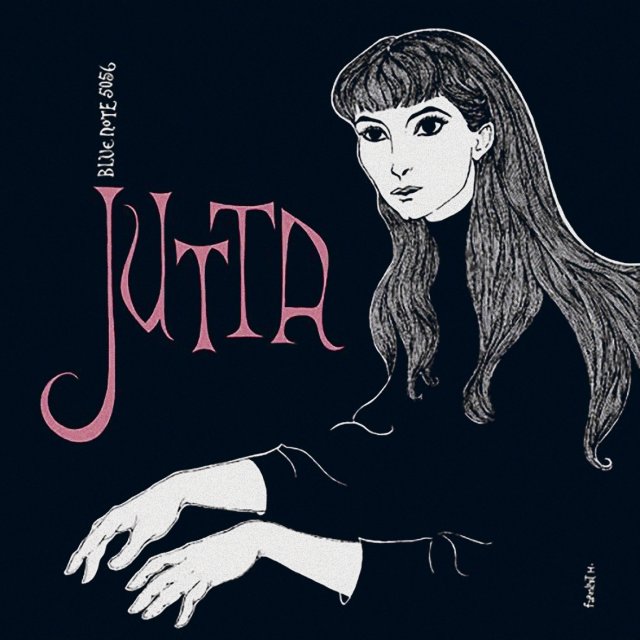- Kultur
- POLITISCHE STRAFJUSTIZ IN DER ÄRA ULBRICHT
Ein Vokabular wie aus Adenauers Zeiten
entspricht auch das Vokabular. Es ist das des „Kalten Krieges“, wodurch sich Werkentins Buch nachteilig von anderen abhebt, die sich, wie z.B. Rottleuthners „Steuerung der Justiz in der DDR“ (Bundesanzeiger 1994), um wissenschaftliche Rechtstatsachenforschung bemühen.
Es ist, gewollt, keine Dokumentation: Der Leser erhält das Material in der vom Autor selektiv aufbereiteten Form; dem Leser ist daher die Möglichkeit zur eigenen Prüfung genommen. (Die Verwechslung des vorletzten DDR-Generalstaatsanwalts Joseph mit dem abgewickelten Berliner Hochschulprofessor Detlef Joseph auf S.11, Anm. 2, mag ein zufälliger Fehler sein).
Unscharf ist die Ge'genstandsbestimmung. Der „politischen Strafjustiz“ werden auch Bösartigkeiten aus anderen Bereichen zugeordnet, so etwa des MfS oder die Zwangsaussiedlung an der Westgrenze durch das Mdl - ganz so, wie man es vor dem Berliner Landgericht beim Umgang mit wegen „Rechtsbeugung“ angeklagten DDR-Richtern beobachten kann.
Das Buch handelt weder in chronologischer Abfolge noch nach juristischen Kriterien folgende „Themen“ ab: „Zugriff
der SED auf die Justiz 1945 bis 1954; Strafjustiz als Hebel der gesellschaftlichen Umwälzung 1949 bis 1961; Justiz und Volksaufstand 1953; Justiz und ?Antifaschismus 1949-1989; Strafjustiz nach dem 13. August 1961; Das Jahr 1968 -Modernisierte Rechtsfassaden und alte Praktiken; Der Richter als Zeremonienmeister; Strafjustiz im Spiegel der Häftlingszahlen.“
Da in den letzten Jahren bereits viel über die politische Strafjustiz der DDR bekanntgemacht worden ist, entbehren weite Passagen des Buches (trotz materialmäßiger Vervollständigung)' des Neuheitswertes: Von der „Aktion Rose“ bis zu dem vom Autor besonders gern erwähnten „Hund von Mühlhausen“ finden wir viele „alte Bekannte“
Neu ist aus meiner Sicht der Beleg dafür, wie intensiv und detailliert die Sowjetunion die (politische) Strafjustiz ihrer deutschen „Kronkolonie“ angeleitet, beobachtet und kontrollierend begleitet hat (S.38 f). Dies gilt natürlich in besonderem Maße für die Waldheimer Prozesse (deren hinreichende Aufhellung auch trotz der wertvollen Untersuchungen Wilfriede Ottos noch aussteht, bis auch die Moskauer
Falco Werkentin: Politische Strafjustiz in der Ära Ulbricht. Reihe Forschungen zur DDR-Geschichte, Bd. I. Christoph Links Verlag, Berlin 1995. 429 S., br., 38 DM.
Archive geöffnet werden). Allerdings: Auch Werkentin unterliegt dem im Umgang mit „Gauck-Akten“ schon häufig beobachteten Irrglauben, daß die aufgefundenen Dokumente per se wahre Aussagen enthalten. Wenn z.B. auf S.183 in einem Bericht über den Fortgang der Waldheimer Prozesse von einer „Kommission“ die Rede ist, die über die Strafmaße befinden solle, so ist bis heute nicht belegt, ob diese Kommission jemals tatsächlich als solche gearbeitet hat, wie sie in relevanten Fällen befand und was sie bewirkte.
Neu sind dem Rezensenten auch Details zum Sturze Fechners, so verschiedene Vorbehalte gegen seine Ablösung durch Hilde Benjamin(S.143 f).
Bei der mir zu knapp erscheinenden Behandlung der Kontrollratsgesetzgebung sollte nicht übersehen werden, daß diese vornehmlich auf die Rolle der Betreffenden in der NS-Zeit (nicht auf einzelne Straftaten!) abstellenden Vor-
schriften (was deutscher Strafgesetzgebung ungeläufig ist) maßgeblich von zwei Vertretern des angloamerikanischen Rechtskreises stammen.
Daß der bereits am 3. Dezember 1945 erlassene SMAD-Befehl 160 nur die (wenig gelungene und nie autorisierte deutsche Übersetzung) entsprechender Bestimmungen (gegen „Diversion“ und „Sabotage“) aus dem sowjetischen Strafrecht war, sollte ebensowenig übersehen werden wie die Tatsache, daß die Wirtschaftsstrafverordnung (WStVO) von 1948 unter risikovollem persönlichen Einsatz des damaligen stellv. Leiters der HA Gesetzgebung in der Deutschen Zentralverwaltung für Justiz, Wolfgang Weiß, in Karlshorst eine deutscher Gesetzgebungstradition gemäße Form angenommen hat, die ihre Parallele in dem Wirtschaftstrafgesetz vom 26.7.1949 der BRD findet, wie überhaupt die historisch unzulässige Eingrenzung auf die DDR dem Leser zahlreiche Parallelen in der Rechtsentwicklung jener Jahre in beiden deutschen Staaten vorenthält (z.B. entschied auch der BGH lange Zeit in politischen Strafsachen in erster und letzter Instanz, also ohne eine Rechts-
mittelmöglichkeit; auch das GG besaß in seinem ursprünglichen Art. 143 eine Strafbestimmung usw.)
Daß das westdeutsche Wirtschaftsstrafgesetz (als ein seltenes Schulbeispiel für ein Zeitgesetz) im Hinblick auf die nach Währungsreform und Marshallplanhifie aufboomende Marktwirtschaft als Hindernis wirkte und außer Kraft gesetzt wurde, ist ebenso selbstverständlich wie das Fortbestehen der 1953 erheblich modifizierten Wirtschaftstraf-Verordnung (WStVO) in einem Lande, in dem soeben die Planwirtschaft in Angriff genommen worden war. Sie hatte in den 60er Jahren, im Gefolge des NÖS, einem völlig anderen Konzept des Wirtschaftsstrafrechts zu weichen. Indessen gehört diese WStVO ebenso wenig zum politischen Strafrecht wie das 1953 wesentlich entschärfte und 1957 aufgehobene Volkseigentumsschutzgesetz (VESchG), das eine völlig ungeeignete und schädliche Kopie Stalinscher Dekrete war.
Unterbelichtet scheint mir die Rolle des Art. VI Abs. 2 der DDR-Verfassung von 1949 zu sein, der in den 50er Jahren das materiell-rechtliche Kernstück des DDR-Staatsschutzes
ausmachte. Die mit ihm gesammelten justitiellen Erfahrungen fanden dann in den betreffenden Vorschriften des Strafrechtsergänzungsgesetzes (StEG) von 1957 ihren gesetzgeberischen Niederschlag.
Aufschlußreich sind die nach Angaben des DDR-Innenministeriums in Tabellen zusammengefaßten Zahlen der Strafund Untersuchungshäftlinge der Jahre 1950-1989. Deren erhebliche Schwankungen lassen die deutlichen Korrekturen der Strafpolitik erkennen, so z.B. 1956 und 1962, sowie die Auswirkungen von Amnestien (S.360 f.) Inwieweit es sich dabei um politische Häftlinge handelte, vermochte Werkentin aufgrund des ihm zur Verfügung stehenden Materials allerdings nicht verläßlich auszumachen, teilt aber mit, daß der Anteil der „Staatsverbrecher“ (inclusive Nazi-Verbrecher) an allen Häftlingen im Zeitraum 1953-1960 von etwa 36 auf etwa 20 Prozent zurückging.
Wer keine Vorkenntnisse über die DDR-Justiz besitzt, muß aus ihrer Darstellung in diesem Buch eine auf totale Diskreditierung der DDR gerichtete Fehlvorstellung ge-
winnen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.