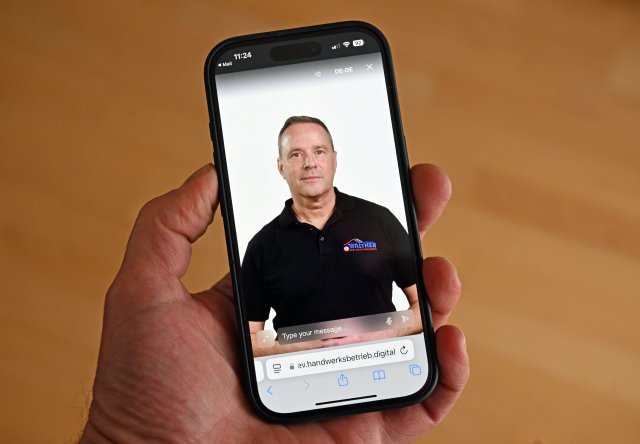Keine Angst vor Lobbyisten
Der SPD-Politiker Karl Lauterbach will bessere Gesundheitsleistungen für die ärmeren Schichten der Bevölkerung. Dafür legt er sich mit Pharmafirmen und Politikern an
nd: Herr Lauterbach, wann haben Sie das letzte Mal mit Daniel Bahr telefoniert?
Ich habe ihm letzte Woche zu seinem Nachwuchs gratuliert. Zu meiner Überraschung ist ihm etwas mit Hand und Fuß gelungen, was für die Gesetze aus seinem Ministerium nicht gilt.
Die Zahl seiner Gesetze müssen Sie erst einmal toppen, wenn Sie als Nachfolger des FDP-Gesundheitsministers ins Rennen gehen ...
Wir werden nicht nach der Papiermenge bewertet, die wir produzieren, sondern nach der Qualität. Daniel Bahr ist ein Ankündigungsminister: Zuerst kommt eine riesige Ankündigung, dann ein brauchbarer erster Vorschlag, der wird dann gezielt verwässert und mit Lobbygruppen abgestimmt. Es folgt ein Gesetz, das nicht funktioniert. Für Lobbygruppen ist das besser als gar kein Gesetz. Ein Beispiel: Mit dem Arzneimittelneuordnungsgesetz sollten sechs Milliarden Euro pro Jahr an Medikamentenkosten gespart werden. 2013 werden es 120 Millionen sein, ein Fünfundzwanzigstel dessen, was ursprünglich geplant war. Für die Arzneimittelindustrie ist das hervorragend. Erst konnte man sich mächtig wehren und am Schluss geht man ungeschoren davon. Was dem Bürger allerdings nie passiert, er wird immer richtig kräftig zur Kasse gebeten. Der Bürger soll geben, die Lobbygruppe soll leben. So ist das System.
Was setzen Sie dem entgegen?
Wir machen Politik gegen Lobbygruppen, für den Verbraucher und Patienten. So wollen wir die Arzneimittelpreise auf das europäische Durchschnittsmaß begrenzen.
Haben Sie mehr Angst vor Ärzten oder vor der Pharmaindustrie?
Man muss jede Stunde taktisch und strategisch denken, sonst wärmt man in der Politik die hinteren Bänke. Man braucht auch Verbündete. So sind die Hausärzte im Vergleich zu Fachärzten unterbezahlt. Der Beruf ist mittlerweile so unattraktiv, dass es zu wenige gibt. Das wollen wir ändern, indem wir sie besser bezahlen und den anderen machen wir ein faires Angebot. Da dürfen Emotionen keine Rolle spielen.
Reißen sie da nicht Gräben auf?
Wenn es so ist, um so besser. Würde ich Minister, verstünde ich mich nicht als Bittsteller, sondern schaute, was die Menschen brauchen. Ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass man Politik gegen die Lobbygruppen machen kann, aber FDP und Union speisen einigen Lobbygruppen in der Gesundheitspolitik aus der Hand.
Sie wollen die Positivliste für Arzneimittel einführen, an der bereits einige Minister gescheitert sind.
Die Positivliste selber ist gescheitert und darüber hinaus Patienten, die Medikamente ohne medizinischen Nutzen bekommen haben, welche zum Teil gefährlich sind. Deutschland ist nicht der Pharma-Mülleimer Europas, wo ich noch Medikamente in den Markt drücken kann, die anderswo verboten sind. Ich erwarte mir von der Positivliste keinen einzigen Euro Ersparnis, sondern den Schutz der Patienten.
Sie planen Versorgungszentren und Assistenten für Ärzte. Haben Sie bei den DDR-Polikliniken und Schwester Agnes abgekupfert?
Unsere Bürgerversicherung ist keine Einheitsversicherung, sie beinhaltet Kassenwettbewerb. Ich finde aber nicht, dass alles, was in der DDR funktioniert hat, automatisch nicht mehr erwogen werden darf. Das ist eine abwegige ideologische Sicht. Eine bessere Vernetzung ambulanter und stationärer Tätigkeit in medizinischen Versorgungszentren, die an Polikliniken im DDR-Stil erinnern, ist für mich kein Problem. Es gibt sie auch in den Vereinigten Staaten.
Sind Sie mit der Art der Rückendeckung für diese Bürgerversicherung in der SPD zufrieden?
Sehr sogar. Zuerst war es eine kleine Truppe, die das mitgetragen hat. Mittlerweile ist das Konsens.
Auch, dass die private Versicherung nicht abgeschafft wird?
Jeder soll gleich behandelt werden. Weshalb soll eine Techniker Krankenkasse die Bürgerversicherung anbieten, die Debeka aber nicht? Alle arbeiten ohne Risikoprüfung, mit einkommensabhängigen Beiträgen, jeder muss genommen werden, es werden gleichen Honorare bezahlt.
Warum will die SPD die Beitragsbemessungsgrenze für Kassenbeiträge behalten? Schonen Sie damit nicht große Einkommen?
Ich komme selbst aus einer Arbeiterfamilie und möchte Menschen mit einer Garage, die sie vielleicht vermieten, oder einem kleinen Sparguthaben schützen. Daher plädiere ich für eine zusätzliche Steuerfinanzierung. Wir würden die Kapitalertragssteuern und die Einkommenssteuer erhöhen. So würde der Gutverdiener stärker belastet und der Niedrigverdiener überhaupt nicht. Oft ist das, was plausibel ist, falsch und das Richtige klingt nicht plausibel. Wenn uns die Linkspartei vorwirft, die großen Einkommen zu schonen, stimmt das einfach nicht. Die Dinge müssen stimmen.
Leiden Sie aus der Perspektive eines Professors unter den Mechanismen der Politik?
Umgekehrt. Ich scheue nicht vor Vereinfachungen zurück. Der eine oder andere würde sich vielleicht wünschen, dass ich differenzierter auftrete, so dass der Bürger das Argument nicht versteht. Von dieser Schonung sehe ich ab. Der Weltmeister im Verdrehen der Argumente ist die FDP. Wir werden für das Enttarnen bezahlt.
Sie werden als Intellektueller oder Alleswisser verspottet ...
Bezeichnete man mich als Nichtskönner oder Leichtgewicht, wäre es schwerer zu ertragen. Ich habe bei Amartya Sen (ein indischer Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph - d.Red.) gelernt zu artikulieren, was ich vorher gespürt habe. Spüre ich nichts, kommt auch nichts. Das Fundament ist das Entscheidende und nicht die Möglichkeit, mich so auszudrücken, dass es andere Wissenschaftler überzeugt.
Sie haben die Agenda 2010 oder Hartz IV als »linkes Projekt« bezeichnet. Die Menschen haben das als ungerecht empfunden.
Will ich Leute in Brot bringen, muss ich mit einem Niedriglohnsektor starten, um den Menschen eine Starthilfe zu geben. Deshalb habe ich die Agenda befürwortet. Der Niedriglohnsektor war beabsichtigt. Jetzt hat die Starthilfe ihren Dienst getan, wird ausgenutzt. Deshalb muss man sie bekämpfen. Dass dies unter Schwarz-Gelb nicht geschah, kann man der SPD nicht vorwerfen.
Ihre Genossen aus der SPD-Linken haben da andere Positionen.
Ich verstehe mich als SPD-Linker, der ein Parteimilieu braucht, in dem man streiten kann.
Warum haben Sie nicht schon in der Großen Koalition die Deregulierung des Arbeitsmarktes bekämpft?
Wir hatten damals noch keine Bundesratsmehrheit, und die Union hat nicht mitgemacht. Die Große Koalition hat uns ja massiv geschadet, wir haben an Glaubwürdigkeit verloren.
Dennoch hält die SPD-Spitze die Tür für Merkel offen, schlägt sie zur Linkspartei aber zu.
Niemand ist willens, mit der Linkspartei zu koalieren.
Sie selbst auch nicht?
Nein. Wenn nach all den Jahren der wichtigste politische Gegner noch immer die SPD ist, muss ich fragen, ob das zukunftsfähig ist.
Haben Sie manchmal das Gefühl, auf eine Frage keine Antwort zu wissen?
Das kommt ja nicht einmal bei Politikern vor, die tatsächlich keine Ahnung in ihrem Bereich haben.
Gibt es im Kopf von Karl Lauterbach eine Vision?
Meine Vision: Die Armen sind in der Lebensqualität und Lebensdauer mit dem Rest der Bevölkerung gleichauf. Die SPD hat übrigens immer eine Vision. Das gilt auch für Grüne und Linkspartei. Die Union hat zu viel Pragmatismus, kaum Visionen. Und die FDP hat weder das eine, noch das andere.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.