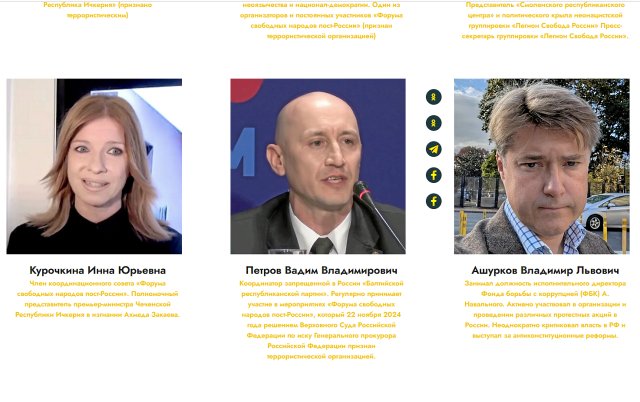Der schwimmende Windpark
Vor Schottlands Nordseeküste soll die weltgrößte treibende Energiefarm entstehen
In dem bis zu einer Volksabstimmung 2014 geführten Streit um eine mögliche Trennung Schottlands vom Königreich haben Befürworter die wirtschaftliche Unabhängigkeit des britischen Nordens stets auch damit zu begründen gesucht, dass es gute Chancen für den Ersatz der schwindenden Erdölbestände in der Nordsee durch Ausbau erneuerbarer Energien gebe. Die Atlantikküste vor Cornwall in Englands Südwesten und die Nordküste Schottlands etwa versprechen größten Energiegewinn aus Wind- und Meereskraft. Nirgendwo sonst an britischen Gestaden sind die Brecher so stark wie dort. Beispielsweise erreichen Wellen im Rockall-Trog westlich Schottlands bis 29 Meter ...
Tatsächlich zeugen schlagzeilenreife Meldungen immer wieder von diesem Alternativpotenzial. Jüngster Fall: das grüne Licht für den weltgrößten schwimmenden Windpark vor Schottlands Nordostküste. Eine Entwicklungsfirma, das norwegische Statoil, schloss einen Leasingvertrag ab, will fünf 6-Megawatt-Turbinen in der Nordsee errichten und ab Ende nächsten Jahres mit ihnen Strom erzeugen. Der Hywind-Park soll 25 Kilometer östlich von Peterhead (nördlich Aberdeens) in der oft stürmischen See treiben. »Treiben« ist das Schlüsselwort. Grundlage jeder Turbine wird eine mit Ballastwasser beschwerte, floatende Stahlröhre sein, die lediglich mit Haltetauen am Meeresboden fixiert ist, während die Windradplattform an der Wasseroberfläche floatet. Das ist neu. Heutige Offshore-Windräder stehen auf Beton-Stahl-Sockeln, die im Meeresboden verankert sind. Diese Lösung gerät jedoch an ihre Kostengrenze, wenn Wassertiefen von 40 Meter und mehr zu meistern sind.
Die Hywind-Turbine dagegen ist ein technischer Pionier im globalen Wettlauf um die Entwicklung ganzer Armadas treibender Turbinen, fähig, die Ozeane zu erobern und die stärksten Windkräfte unseres Planeten anzuzapfen. Aktuell befinden sich weltweit mehr als über 40 ähnliche Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die meisten lassen sich von den Erdöl- und -gasplattformen anregen, die seit Langem Wind und Wetter trotzen. Offshore-Windparks haben den Vorteil, dass Menschen sie eher tolerieren als landgestützte Windradfarmen.
Der Meeresboden in der nun verpachteten Zone vor Schottlands Küste steht unter Verwaltung des Crown Estate, des Kronguts im Besitz der Krone. Wie die Kronjuwelen im Tower von London gehört der Estate der Queen, ist aber nicht deren Privateigentum und kann folglich auch nicht von ihr (oder ihrem Thronfolger) verkauft werden. Das Gesamtportfolio des Crown Estate hatte 2013 den königlichen Wert von 8,6 Milliarden Pfund. Das Krongut erteilte Statoil jetzt die Betriebserlaubnis für Hywind. »Wir freuen uns sehr, dieses Projekt in Schottland verwirklichen zu können, einer Region mit enormen Windressourcen und großem Knowhow aus der Öl- und Gasindustrie«, sagte Leif Delp, Direktor für Hywind Scotland, dem Londoner »Guardian«.
Mehr als 90 Prozent der weltweiten Offshore-Windkraft-Kapazität wird momentan in Nordeuropa errichtet. Britannien hat den größten nationalen Anteil. Doch die deutsche Aktie an küstennahen Windkraftanlagen wächst derzeit noch schneller als auf der Insel, auch Japan, China und die USA legen stark zu. Offshore-Windenergie macht global erst drei Prozent aller Windkraftenergie aus, gilt aber als vielversprechend für die Zukunft, umso mehr, als Lizenzen für landgestützte Windparks immer zögerlicher erteilt werden - auch im Königreich. »Schwimmende Offshore-Windanlagen hingegen sind eine aufregende Technologie mit riesigem, weltweitem Potenzial, und es ist toll, dass es zur Premiere auf diesem Gebiet in schottischen Gewässern kommen wird«, erklärte Lindsay Roberts von Scottish Renewables, der Dachorganisation für den Einsatz erneuerbarer Energien.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.