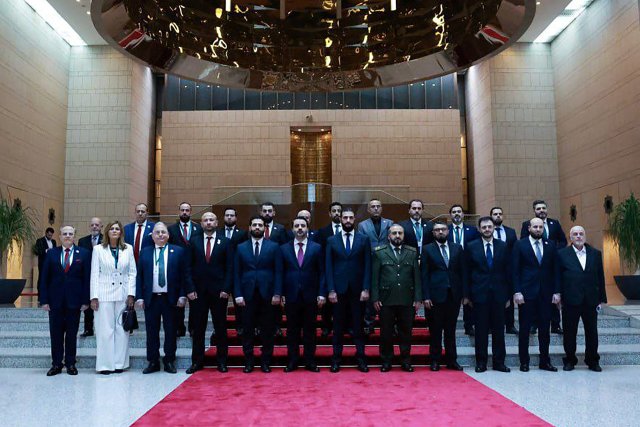Katerwoche in Kolumbien oder: Der geplatzte Frieden
Frustration und Resignation: Was hat der Brexit mit dem Referendum über den Friedensschluss mit der FARC zu tun?
Die Kolumbianer haben wieder einmal gezeigt, wie sehr das Wort ihres bedeutendsten Denkers, des 1927 in Aracataca geborenen und 2014 in Mexiko-City gestorbenen Literaturnobelpreisträgers Gabriel García Márquez, wahr ist: »Es ist leichter einen Krieg anzufangen, als ihn zu beenden.« Mit ihrem »Nein« zum Friedensschluss mit der FARC, um den die letzten vier Jahre so heftig wie intensiv diskutiert und verhandelt wurde, haben sie für einen ultimativen Demokratie-Schocker gesorgt – nicht nur national, auch international.
Eigentlich war die Abhaltung des Referendums nicht zwingend nötig. Ebenso wie die in diesem Jahr gleichfalls, zumindest europaweit zu einer Schockstarre führende Entscheidung der Briten über ihren Austritt aus der Europäischen Union. Der mittlerweile zurückgetretene britische Premier David Cameron hat sich gründlich verspekuliert. Er hatte mit der Volksbefragung eigentlich nur eine Drohkulisse aufbauen wollen, sich einen Joker im Poker mit seinen europäischen Amtskollegen erhofft. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos wiederum insistierte auf das Plebiszit, um seinen Deal mit der Guerilla zu legitimieren um seine Machtposition zu festigen. Doch auch er hat sich gründlich verkalkuliert.
Politisch als auch verfassungsrechtlich bestand kein Zwang, das kolumbianische Volk - ein weiteres Mal - zu befragen. Santos ist erst vor zwei Jahren wiedergewählt worden, als die Verhandlungen mit der FARC schon längst im Gang waren. Damit hatte er de facto schon die Bestätigung für seine Befriedigungspolitik erhalten. Warum begnügte er sich nicht mit diesem Plazet?
Sein größter Herausforderer, José Harrinson Zuluaga von der Partei Centro Democratico des Ex-Präsidenten Àlvaro Uribe, ergriff die Steilvorlage, die ihm Santos bot mit Vergnügen und mobilisierte kräftig gegen das Friedensabkommen mit der FARC.
Doch nicht nur, dass die Kolumbianer mit dem Urnengang 2014 bereits ihren Wunsch auf eine endliche Beendigung des fünf Jahrzehnte währenden Bürgerkrieges artikuliert hatten. Auch das Verfassungsgericht hatte bereits, ein Jahr zuvor, grünes Licht gegeben, die rechtliche Grundlage eines verhandelten Friedens bestätigt. Dennoch wollte Santos sich noch einmal durch ein Referendum legitimieren lassen. Und steht jetzt vor einem ähnlichen Scherbenhaufen wie die politischen Pokerspieler in Großbritannien.
Eine weitere interessante Parallele zur Brexit-Wahl ist, dass die Gegner des Friedensvertrags das Referendum offenbar als eine Art sportlichen Wettkampf ansahen, das Augenmerk schon auf die Präsidentschaftswahl 2018 und ihre jeweiligen Chancen richteten, bar jeglichen politischen und gesellschaftlichen Verantwortungsgefühls für aktuelle Notwendigkeiten. Der Politologieprofessor Felipe Botero von der Universidad Andes in Bogotá erklärte, das Ziel der Uribistas (die politischen Kräfte hinter Ex-Präsident Uribe) habe darin bestanden, zwar ein möglichst gutes Ergebnis bei der Abstimmung zu erzielen. Mit einem Sieg hätten sie selbst nicht gerechnet. Sie wollten ein gutes Ergebnis lediglich als Faustpfand erreichen. Um in zwei Jahren, in der heißen Wahlkampfphase, die Kolumbianer daran zu erinnern, als einzige Kraft die - bis dahin gewiss noch längst nicht gänzlich überwundenen – Probleme infolge des Krieges vorausgesehen und gewarnt zu haben. Die Fundamentalopposition zum Friedensprozess war ein wahltaktisches Manöver. Und deswegen gehören zu den Überraschten dieses Resultates in Kolumbien auch die Anhänger der No-Kampagne. Ein hauchdünner Sieg der Befürworter des Friedens wäre ihnen recht gewesen, einen Triumph ihrer Kampagne haben sie nicht erwartet.
Wir haben noch in guter, oder besser: böser Erinnerung, wie am Tag nach der Wahl in Groß-Britannien sich ein Brexitaner nach dem anderen – verkatert und überrascht – aus dem Staub machte und die von ihm gennaseweiste eigene Wählerschaft düpierte. Ob sich die Fürsprecher des »No« in Kolumbien sich ähnlich davonschleichen werden, sei dahingestellt. Ihre Versprechen könnten sich aber ebenso als leere Worthülsen herausstellen. Denn es gibt keine Alternative für Land und Volk als die Beendigung des Krieges, der bis jetzt über 200 000 Todesopfer und Millionen Opfer von Vertreibung, Vergewaltigung und Folter gefordert hat.
Die Uribistas selbst beteuerten, man wolle auch Frieden, nur einen besseren. Den wollte man in Neuverhandlungen erreichen. Nur: Es ist überhaupt nicht klar, wer mit wem jetzt neu oder weiter verhandeln soll. Die Regierung Santos hat ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen, steht für und hinter den mit der FARC ausgehandelten Vertrag. Für Neuverhandlungen hat sie weder politischen Kredit noch politisches Kapital.
Die FARC hat dem Frieden zugestimmt und sich öffentlich beim kolumbianischen Volk für alles Unrecht, alles Leid und alle Opfer, die es ihm zugefügt hat, Jahrzehnte entschuldigt. Selbst die »Frente«, die Untereinheiten der Guerilla, die während der Verhandlungen andeuteten, sich nicht einem Friedensabkommen zu unterwerfen, sind umgeschwenkt. Der Verhandlungsführer der FARC, Rodrigo Londoño, konnte die Reihen seiner Kampfgruppen geschlossen halten und letztlich für den Friedensvertrag gewinnen. Ob das in Zukunft auch so bleiben wird, ist nunmehr mehr als fraglich. Das überraschende Referendum gibt eher Anlass für Resignation statt Optimismus. Es steht zu befürchten, das Kolumbien erneut unruhigen Zeiten entgegengeht.
Auch der letzte noch verbliebene Ausweg aus dem Dilemma, nämlich eine neue Verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, wirft mehr Fragen auf als Antworten. Denn laut geltendem Recht muss mindestens ein Drittel der wahlberechtigten Kolumbianer für eine Versammlung stimmen, d.h. in etwa 11,6 Millionen. Zum Referendum sind insgesamt knapp mehr als 12 Millionen Menschen an die Wahlurne getreten. Über die Gründe mag man streiten: War es Gleichgültigkeit oder die vermeintliche Gewissheit unter den Kolumbianern, das die eigene Stimme nicht ausschlaggebend sei, es für ein »Ja« zum Frieden reichen wird. Die Vorhersagen gaben den Befürwortern des Friedens – und dies ist ein Unterschied zur britischen Wahl – einen bequemen Vorsprung von 60 Prozent der Stimmen. Umso überraschender und bitterer das tatsächliche Ergebnis.
Jedenfalls erscheint es eher unwahrscheinlich, dass sich für die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung noch einmal mindestens zwölf Millionen Menschen mobilisieren lassen. Frustration und Resignation dürften inzwischen nicht kleiner geworden sein, eher umgekehrt.
Das Land, das noch vor einer Woche zuversichtlich in eine lichte Zukunft blickte, befindet sich jetzt in einer dunklen Sackgasse. Das ist die eigentliche Tragik und auch der große Unterschied zum Referendum in Großbritannien. Während auf der Insel »lediglich« die freiwillige Mitgliedschaft in einem politischen Bündnis zur Abstimmung stand, ging es in Kolumbien um Krieg oder Frieden. Die Opfer hatten eine eindeutige Meinung: die von dem Konflikt am meisten in Mitleidenschaft gezogenen Gebiete Kolumbiens stimmten überwältigend für den Friedensvertrag.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.