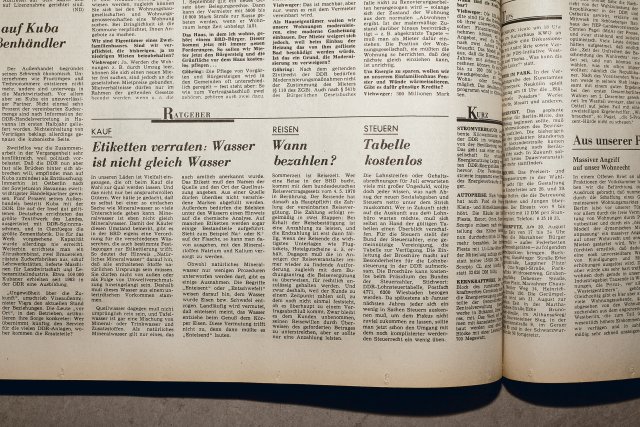- Ratgeber
- Schuldrechtsanpassungsgesetz
Wenn der Grundstückeigentümer den Nutzungsvertrag kündigt
Rolf S., 15890 Eisenhüttenstadt
Mit der abgelaufenen Investitionsschutzfrist für Garagen auf fremdem Grund sind die Festlegungen des Schuldrechtsanpassungsgesetzes (SchuldRAnpG) wieder stärker ins Blickfeld der Grundstücksnutzer gerückt. Zuallererst: Dieses Gesetz vom September 1994 (Novellierung vom Mai 2002) mit seinem gestaffelten Kündigunggsschutz und den Entschädigungsregelungen gilt nur für Grundstücksnutzer, die einen Nutzungsvertrag nach §§ 312 bis 315 Zivilgesetzbuch der DDR abgeschlossen haben, und zwar bis zum 3. Oktober 1990. Wer nach diesem Datum einen Vertrag einging, für den regeln sich alle Fragen nach dem BGB. Für ihn trifft das SchuldRAnpG nicht zu. Davon sind drei der in der Leseranfrage genannten Nutzer betroffen, die erst nach 1990 gepachtet haben.
Die Kündigungsschutzfristen des SchuldRAnpG regeln sich nach § 23. In Abs. 3 heißt es: »Vom 1. Januar 2005 an kann der Grundstückseigentümer den Vertrag auch dann kündigen, wenn er das Grundstück
1. zur Errichtung eines Ein- und Zweifamilienhauses als Wohnung für sich, die zu seinem Hausstand gehörenden Personen oder seine Familienangehörigen benötigt oder
2. selbst ... zur Erholung oder Freizeitgestaltung benötigt und der Ausschluss des Kündigungsrechts den Grundstückseigentüme angesichts seines Erholungsbedarfs und seiner sonstigen berechtigten Interessen auch unter Berücksichtigung der Interessen des Nutzers nicht zugemutet werden kann.«
Der Eigentümer kann den Nutzungsvertrag aber auch kündigen, wenn er das Grundstück einem besonderen Investitionszweck, z. B. dem Wohnungsbau, zuführen will. Abs. 4 des Gesetzes bestimmt: »Vom 4. Oktober 2015 an kann der Grundstückseigentümer den Vertrag nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen (also nach BGB - d.Red.) kündigen.«
Hier gilt auch die siebenjährige Investitionsschutzfrist, so dass ab 4. Oktober 2022 die Wirkung des SchuldRAnpG für alle nach ZGB der DDR abgeschlossenen Nutzungsverträge endet.
Wenn ein Grundstückseigentümer den Vertrag kündigt, muss er die eventuell im Nutzungsvertrag festgelegten Kündigungsfristen oder - was zumeist angewandt wird - § 580 a BGB beachten. Danach kann die Kündigung bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats erfolgen. Die langjährige Nutzung eines Grundstücks spielt bei einer Kündigung (leider) keine Rolle.
Die Entschädigung für das Bauwerk regelt sich nach § 12 SchuldRAnpG. Dazu sagt Abs. 2: »Endet das Vertragsverhältnis durch Kündigung des Grundstückseigentümers, ist die Entschädigung nach dem Zeitwert des Bauwerks im Zeitpunkt der Rückgabe des Grundstücks zu bemessen.«
Was Bauwerke sind, ist im § 5 des Gesetzes festgelegt. Danach sind es Gebäude, Baulichkeiten nach § 296 Abs. 1 Zivilgesetzbuch der DDR und Grundstückseinrichtungen, die insbesondere zur Einfriedung und Erschließung des Grundstücks erforderlich sind, wie etwa feste Zäune, Entwässerung, Stromversorgung, Brunnen usw. - wenn der Nutzer dies finanziert hat.
§ 27 setzt noch eins drauf: »Nach Beendigung des Vertrages hat der Grundstückseigentümer dem Nutzer neben der Entschädigung für das Bauwerk auch eine Entschädigung für die Anpflanzungen zu leisten ...« Es müssen also auch Baumpflanzungen, Hecken und andere langlebige Anpflanzungen bedacht werden, die, wohlgemerkt, der Nutzer angelegt hat. Entschädigung für das Mobiliar, auch wenn es eigens für den Bungalow beschafft wurde, wird nicht gezahlt. Alles bewegliche Eigentum kann der Nutzer ja nach der Kündigung mitnehmen.
Die Nutzer sollten bei Kündigung aber auch prüfen, ob der Bodeneigentümer künftig das Grundstück selbst zu Erholungszwecken nutzen oder es erneut für diese Zwecke verpachten will. Dann kann der Nutzer eine Entschädigung verlangen, weil der Verkehrswert des Grundstücks durch ebendas gut erhaltene Wochenendhaus erhöht ist. So bestimmt es § 12 Abs. 3.
Problematisch ist und bleibt die Abrissregelung. Der Nutzer ist bei Vertragsbeendigung zur Beseitigung eines entsprechend den Rechtsvorschriften der DDR erichteten Bauwerks nicht verpflichtet. Er hat jedoch die Hälfte der Kosten für den Abbruch des Bauwerks zu tragen (§ 15 Abs. 1). Das gilt, wenn der Nutzer selbst das Vertragsverhältnis beendet hat, das Vertragsverhältnis vom Grundstückseigentümer nach Ablauf der in § 12 bestimmten Fristen vom Grundstückseigentümer gekündigt wird ... , oder wenn der Abbruch innerhalb eines Jahres nach Besitzübernahme durch den Grundstückseigentümer vorgenommen wird. Der Grundstückseigentümer hat dem Nutzer den beabsichtigten Abbruch des Bauwerks rechtzeitig anzuzeigen. Und der Nutzer kann die Beseitigung selbst vornehmen oder vornehmen lassen.
Die Gerichte haben bisher recht unterschiedlich zu Abrisskosten und Entschädigungen entschieden. In diesen schwierigen Fragen ist deshalb jedem Nutzer dringend zu raten, sich anwaltlichen Beistand zu sichern oder sich von einem entsprechenden Verband oder Verein beraten zu lassen. RBL
Weitere Informationen und Ratgeber: VDGN (Verband Deutscher Grundstücksnutzer e.V.), Irmastr. 16, 12683 Berlin, Tel. 030/ 514 888 0, www.vdgnev.de
VKSG (Verband der Kleingärtner, Siedler und Grundstücksnutzer e.V.), Hohenschönhauser Str. 80, 10369 Berlin, Tel. 030/972 10 69, www.vksg.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.