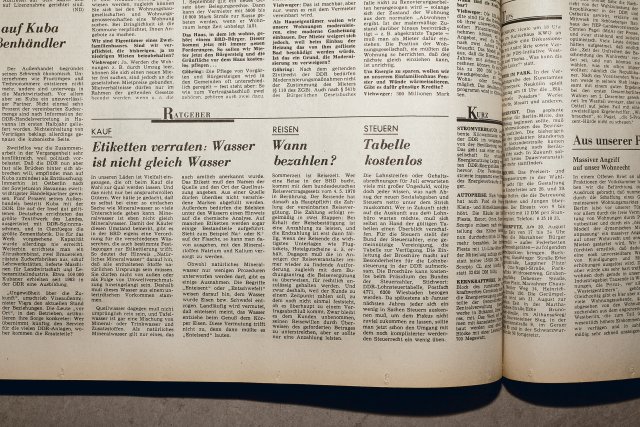- Ratgeber
- Impfpflicht
Steigende Quoten der Masernfälle
Die Zahl der Masernfälle in Europa hat nach Angaben der WHO einen höchsten Stand erreicht

Insgesamt wurden in der WHO-Region Europa, die 53 Länder bis nach Zentralasien umfasst, im vergangenen Jahr 127.350 Erkrankungen und 38 Todesfälle durch die Masern registriert. »Die Masern sind zurück, das ist ein Weckruf«, erklärte WHO-Europadirektor Hans Kluge. Bei der Hälfte der in Europa registrierten Masern-Fälle war eine Krankenhausbehandlung der Infizierten notwendig. Etwa 40 Prozent der Patienten mit Masern waren Kinder unter fünf Jahren. Laut der WHO hatten im Jahr 2023 insgesamt rund 500.000 Kinder in der Region nicht ihre erste Masern-Impfdosis erhalten.
Eine Kinderkrankheit, die auch ungeimpfte Erwachsene erleiden
Masern sind eine der ansteckendsten Krankheiten des Menschen überhaupt. Das Virus löst bei fast allen ungeschützten Menschen Symptome aus. Dazu gehören Fieber, Husten und der typische Hautausschlag, der sich über den ganzen Körper ausbreitet. Komplikationen sind Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen und Gehirnentzündungen, die zu schweren Folgeschäden wie geistigen Behinderungen und Lähmungen führen können. Obwohl die Masern landläufig oft als typische Kinderkrankheit wahrgenommen werden, können sich auch ungeimpfte Erwachsene infizieren.
Um die Masern auszurotten, müssen mindestens 95 Prozent einer Bevölkerung vollständig gegen die Krankheit geimpft sein. In Deutschland wurde vor fünf Jahren eine Masern-Impfpflicht für Kita- und Schulkinder eingeführt. Doch vor allem seit 2023 steigt die Zahl der Fälle wieder stark an, unter anderem wegen eines Rückgangs der Impfungen während der Corona-Pandemie.
Vermutlich hatte jeder schon mindestens einmal, oftmals ohne es zu wissen, eine Infektion mit RSV, dem Respiratorischen Synzytial-Virus. Das Erkältungsvirus ist weltweit verbreitet, man geht davon aus, dass sich jedes Kind bis zum Ende des zweiten Lebensjahres damit ansteckt. Für Säuglinge kann RSV sehr gefährlich werden.
Vor allem bei Babys schwere Atemwegserkrankungen
Seit dem Jahr 2024 hat die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) eine Immunisierung gegen das Virus für alle Säuglinge empfohlen. Denn im Gegensatz zu gesunden Erwachsenen, die bei einer RSV-Infektion meist nur die typischen Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen spüren, kann es bei Risikogruppen, zu denen auch Säuglinge unter sechs Monaten gehören, zu schweren Atemwegserkrankungen kommen. Unter Umständen müssen sie sogar beatmet werden. Durch Entzündungen im Bereich der Lunge und die erhöhte Schleimproduktion können sich die Atemwege verengen, was bis hin zu Atemnot und Atemaussetzern führen kann. Die Infektion kann tödlich verlaufen – zum Glück ist das aber sehr selten der Fall.
Die Impfung für Säuglinge gegen RSV wird zwar, wie viele andere Impfungen auch, in den Muskel gespritzt, ist aber keine »herkömmliche« Impfung, wie wir sie etwa gegen Tetanus oder Masern kennen. Ärzte sprechen bei der Impfung gegen RSV von einer »passiven Immunisierung«. Normalerweise regen Impfstoffe den Körper an, Antikörper gegen Erreger zu produzieren. Bei einer passiven Immunisierung dagegen wird der Antikörper direkt verabreicht. Dieser wird meist gut vertragen. Es kann zur vorübergehenden Lokalreaktionen kommen, die meist nach ein paar Tagen abklingen.
RSV-Impfstoff seit 2024 auch für Schwangere zugelassen
Seit 2024 ist außerdem ein RSV-Impfstoff zugelassen, mit dem Schwangere geimpft werden können. Das Immunsystem der Mutter produziert nach dieser Impfung Antikörper, die über die Plazentaden Fötus erreichen. Das Neugeborene ist so nach der Geburt geschützt – vorausgesetzt, die Impfung fand mindestens zwei Wochen vor Geburt statt, denn so lange braucht es etwa, bis sich Antikörper bilden.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt derzeit die RSV-Impfung in der Schwangerschaft nicht. Mehrere Fachgesellschaften, darunter der Berufsverband der Frauenärzte und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, raten dagegen zur Impfung ab der 32. bis zur 36. Schwangerschaftswoche, wobei der Entbindungstermin in die RSV-Saison fallen muss.
Fünf Jahre nach der Einführung einer Impfpflicht gegen Masern bewertet eine Expertenrunde diese als Teilerfolg. Die Impfquote sei trotz der Corona-Pandemie und der Anlaufschwierigkeiten gestiegen, heißt es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI). Gleichzeitig habe die Impfpflicht Kosten verursacht und Teile der Bevölkerung verärgert.
Das Robert-Koch-Institut berichtet in seinem aktuellen Epidemiologischen Bulletin (10/2025) über einen Workshop, an dem im November des vergangenen Jahres unter anderem Vertreter von Gesundheitsämtern, Ärzte, Kitaleitungen, Forschende und der Deutsche Ethikrat teilnahmen. Ein Fazit: »Um die Erfolgsaussichten der Impfpflicht in den nächsten fünf Jahren zu verbessern, muss noch einiges getan werden.«
Seit der Einführung der Masernimpfpflicht in Deutschland im März 2019 ist die Impfquote dem RKI zufolge gestiegen. Die Masernimpfpflicht wurde eingeführt, nachdem es wiederholt zu Masernausbrüchen gekommen war und andere Maßnahmen die Impfquote nicht erhöht hatten. Der Anteil zweifach geimpfter Kinder im Alter von 24 Monaten stieg von 70 Prozent im Jahr 2019 auf 77 Prozent im Jahr 2023. Der Anteil der zweifach geimpften Sechsjährigen stieg von 89 Prozent im Jahr 2019 auf 92 Prozent im Jahr 2023. Allerdings seien damit weiterhin auch Kinder ungeimpft und damit ungeschützt, heißt es in dem Bericht.
Kita- und Schulkinder müssen Masernimpfung nachweisen
Das Masernschutzgesetz legt fest, dass Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind und eine Kita oder Schule besuchen, einen Masernschutz nachweisen müssen, entweder durch zwei Impfstoffdosen oder eine labordiagnostisch bestätigte Erkrankung. Andernfalls können die Kinder nicht in die Betreuungseinrichtung aufgenommen werden beziehungsweise drohen bei Schulkindern Bußgelder.
Die Umsetzung war nach Ansicht der Fachleute mit einigen größeren Herausforderungen verbunden. Zum einen sei sie durch die Corona-Pandemie verzögert worden, zum anderen seien Zuständigkeiten unklar gewesen. Manchmal fehlten auch Dokumentenvorlagen oder es gab rechtliche Unsicherheiten, wie aus dem Bericht des RKI über den Workshop hervorgeht. Nicht zuletzt hätten Impfgegner immer neue Wege gefunden, Impfungen zu verzögern oder zu umgehen, etwa in dem sie eine Impfunfähigkeit angaben. Einige Kitas und Schulen schienen auch überfordert zu sein.
60 Prozent der Eltern stehen der Impfpflicht positiv gegenüber
Eltern berichteten in einer Befragung von Verzögerungen. So hätten 2022 etwa ein Drittel der befragten Eltern noch keinen Nachweis über eine Masernimpfung erbringen müssen. Das geht aus der vom RKI durchgeführten Längsschnittstudie zur Evaluation der Impfakzeptanz unter dem Masernschutzgesetz (LEIA) hervor. Während etwa 60 Prozent der Eltern der Impfpflicht positiv gegenüberstanden, habe es in Einzelfällen Ärger darüber gegeben.
Auch hätten sich Hinweise ergeben, dass die Impfpflicht für Masern dazu geführt habe, andere freiwillige Impfungen der Kinder auszulassen – »ein Warnsignal für Public Health«, heißt es im RKI-Bericht. Konkrete Zahlen dazu gab es in dem Bericht nicht.
Masern sind den Fachleuten zufolge weiterhin ein relevantes Problem. Insbesondere bei lokal geringeren Impfquoten kommt es in Deutschland immer wieder zu Ausbrüchen, so etwa Anfang des vergangenen Jahres in Berlin oder im Jahr 2023 in Halle. Eine Herdenimmunität von 95 Prozent der Bevölkerung ist laut dem RKI nötig, um Masern auszurotten. dpa/nd
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.