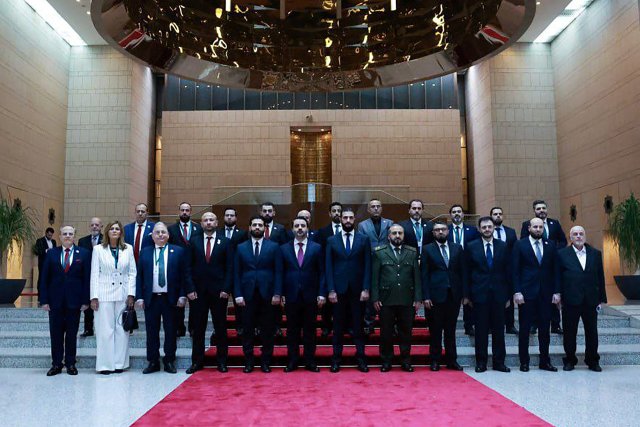Eine tolle Arbeit, viel zu schlecht bezahlt
Der Niedrigverdiener Daniel Turek über Leiharbeit, den Mindestlohn und das deutsche Streikrecht
Daniel Turek entspricht in vielerlei Hinsicht nicht dem, was man sich unter einem klassischen prekär Beschäftigten vorstellt: Er ist männlich, arbeitet in der Logistik und hat eine unbefristete Vollzeitstelle in einem Unternehmen im Verantwortungsbereich des Landes Berlin. Und doch: Daniel Turek verdient so wenig, dass er sich selbst als »Prekären« bezeichnet.
Eine offiziell in Deutschland gültige Definition davon, wann ein Arbeitsverhältnis prekär ist, gibt es nicht. Der Arbeitssoziologe Klaus Dörre von der Universität Jena definiert es so: »Als prekär kann ein Erwerbsverhältnis bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales Integrationsniveau sinken, das in der Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert und anerkannt wird.« Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Arbeitsplatz unsicher ist, wie bei Leiharbeit und Dauerbefristungen. Oder aber wenn - durch ungewollte Teilzeitarbeit, Minijobs oder niedrigen Lohn - das Geld trotz Arbeit knapp ist.
Im Wahlkampf sagen Politiker gern, was die Wähler wollen. Wir haben Bürgerinnen und Bürger selbst gefragt, was ihnen wichtig ist und was sie von der Politik erwarten. Wir haben die Versprechen der Parteien genauer angeschaut und nach guten Lösungen im Sinne der Bürger Ausschau gehalten.
Dafür hat “nd” folgende Menschen getroffen:
nd hat getroffen: einen Hochschulangestellten aus Cottbus, einen Kitaerzieher aus Gifhorn, einen Facharbeiter aus Berlin, eine geflüchtete Frau aus Syrien, einen Niedriglohnbeschäftigten aus Berlin, einen Wohnungslosen aus Hannover, einen Rentner aus Berlin, einen Studierenden aus Kassel, eine Erwerbslose aus Löbau (erscheint am 22. September).
Lesen Sie diese und viele weitere Texte zur Bundestagswahl 2017 unter: dasND.de/btw17
Letzteres macht Turek zur Gruppe der prekär Beschäftigten zugehörig. Denn sein Monatsverdienst ist bescheiden: Mit seiner 40-Stunden-Woche kommt Turek heute auf gerade mal 1200 Euro netto im Monat, 1695 Euro beträgt sein Bruttoeinkommen.
Der 32-jährige zweifache Vater hat Abitur und ist gelernter Versicherungskaufmann. In die Lehre gegangen ist er bei der Deutschen Bank 24. Doch die Branche war nichts für ihn. Heute ist Turek Versorgungsassistent am Benjamin Franklin Campus der Charité in Berlin. »Ich liebe meinen Job«, sagt er. Die Kollegen seien toll, das ganze Umfeld überaus angenehm. Als Versorgungsassistent ist er verantwortlich für die Bestellung und Zulieferung aller Verbrauchsmaterialien in dem Krankenhaus. Ohne ihn und seine 19 Kollegen gibt es keine Spritzen, Binden oder Pflaster auf den Stationen. »Es ist eine unglaublich sinnvolle und dankbare Tätigkeit, den Ablauf eines Krankenhausbetriebes mit zu ermöglichen«, findet Turek.
Es gibt jedoch das große Aber. Und dieses Aber ist der Lohn. Alle nicht-pflegerischen und nicht-ärztlichen Tätigkeiten an der Charité wurden bereits vor zehn Jahren in die Tochtergesellschaft Charité Facility Management GmbH (CFM) ausgelagert. Die Beschäftigten fielen damit aus dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Löhne auf im Schnitt 7,50 pro Stunde. Im Vergleich zu einem nach TVöD bezahlten Angestellten, der die gleichen Tätigkeiten verrichtet, ergab das einen Unterschied von mehreren hundert Euro Bruttomonatsverdienst. Dagegen und für einen Tarifvertrag trat die CFM-Belegschaft 2011 in einen elfwöchigen Streik.
Zu dieser Zeit kam Daniel Turek an die Charité. Er hatte zuvor seinen Job als Versicherungskaufmann an den Nagel gehängt, bei einer Zeitarbeitsfirma angeheuert und wurde von dieser als Streikbrecher in die CFM geschickt. Kurz darauf wurde er von der CFM fest angestellt. Heute ist er selbst Streikaktivist. Denn den Tarifvertrag gibt es noch immer nicht.
Ein Teilerfolg kam nach dem Arbeitskampf 2011 aber dennoch zustande: Wegen der sich damals abzeichnenden Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes durch die schwarz-rote Bundesregierung war die Geschäftsführung der CFM bereit, 8,50 Euro pro Stunde schon früher an die Beschäftigten zu zahlen. Daniel Turek hat also persönlich von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohn - sogar eher als alle anderen - profitiert. Hat sich das in seinem Geldbeutel bemerkbar gemacht? »Ja, schon etwas«, sagt Turek. Aber große Sprünge habe er nicht machen können. Denn gleichzeitig werde vieles teurer, die Miete zum Beispiel. Zum Jahresbeginn wurde Tureks Miete um 80 Euro erhöht. Wiegt er die steigenden Lebenshaltungskosten gegen seine Lohnentwicklung der letzten Jahre auf, bleibt am Ende weniger übrig.
Daniel Turek kommt mit seinem Einkommen aus, auch weil seine Partnerin berufstätig ist und ein höheres Einkommen hat als er selbst. »Man gewöhnt sich auch daran, mit 1200 Euro zu leben«, sagt er. Aber die Ansprüche müssten dann eben runtergeschraubt werden. Urlaube, Lernmittel für die Kinder oder Ausflüge gehen nicht einfach so »nebenbei«, sondern müssen geplant und einkalkuliert werden.
Auch für eine solide Altersvorsorge reicht es nicht. Altersarmut sei für ihn, obwohl erst Anfang 30, ein großes Thema - und auch bei seinen Kollegen eine der größten Sorgen überhaupt. Findet er diesbezüglich sinnvolle Vorschläge in den Programmen der Parteien zur Bundestagswahl? »Ach naja, große Versprechen machen ja alle«, winkt Turek ab. Glaubwürdig findet er Politiker nicht. Und richtiggehend wütend macht ihn die SPD: »Vor kurzem wurde ein Antrag auf das Verbot von sachgrundlosen Befristungen abgelehnt von der SPD, obwohl es mit ihren Stimmen eine Mehrheit im Bundestag dafür gegeben hätte. Dafür lassen sie sich für die Ehe für alle feiern«, ärgert er sich. Turek hätte sich hier mehr Konfrontationsbereitschaft der Sozialdemokraten und »Arsch in der Hose« gewünscht.
Während er ein Verbot von sachgrundlosen Befristungen begrüßen würde, ist Daniel Turek nicht grundsätzlich für ein Verbot von Leiharbeit. »Um punktuell besondere Auftragsspitzen ausgleichen zu können, sollte es das schon geben«, sagt er. Aber teuer müsse es dann für die Unternehmen sein - so wie in Frankreich. Dort, so hat er es gehört, werde Leiharbeitern ein höherer Lohn gezahlt als den Stammbeschäftigten, um den Nachteil der befristeten Anstellung auszugleichen. Wäre Leiharbeit auch in Deutschland derart gestaltet, dann, glaubt Turek, würde sie auch nicht mehr dazu missbraucht, geregelte durch prekäre Beschäftigung zu ersetzen.
Was würde er durchsetzen, wenn er einen Wunsch an die Politik frei hätte? »Einen gesetzlichen Mindestlohn von 12,50 oder 13 Euro«, sagt Turek. Ein gesetzlicher Mindestlohn von 13 Euro würde sein Bruttogehalt auf rund 2250 Euro im Monat erhöhen. Und Turek schiebt gleich noch einen zweiten Wunsch hinterher: Die Erweiterung des Streikrechts. Nicht nur tariffähigen Forderungen sollte mit Arbeitskämpfen Nachdruck verliehen werden dürfen, sondern auch anderen Anliegen. »Dürften Arbeitnehmer zum Beispiel auch gegen Outsourcing streiken, dann wäre das mit der CFM gar nicht erst passiert«, ist er überzeugt. Denn die Belegschaft war vor zehn Jahren gegen die Gründung der CFM, etwas dagegen tun konnte sie aber nicht. Dass eine der Parteien seine Anliegen umsetzt, glaubt er nicht. Er wird trotzdem seine Stimme abgeben. Denn: »Wer nicht wählen geht, braucht sich über Politik auch nicht zu beschweren.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.