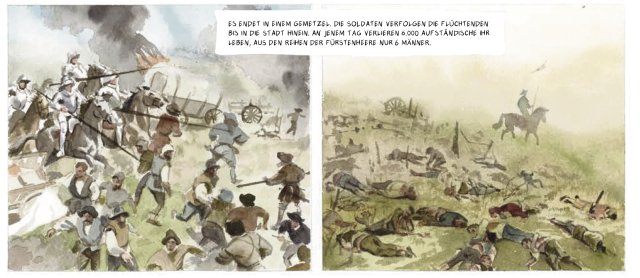Fehlalarm im Gehirn
Neurowissenschaftler ergründen, warum Menschen zu übersteigerten Angstreaktionen neigen.
Wie Freude, Ekel, Wut und Traurigkeit gehören auch Furcht und Angst zu den Grundgefühlen, die das Wesen der menschlichen Existenz prägen. Und zwar in allen Kulturen. Das heißt, überall auf der Welt stellt sich bei Menschen, die in eine als bedrohlich empfundene Situation geraten, ein unlustbetonter emotionaler Zustand ein, der mit typischen körperlichen Reaktionen einhergeht. Als da wären: Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, beschleunigte Atmung, Schwitzen, gesteigerte Muskelanspannung.
Gewöhnlich wird im alltäglichen Sprachgebrauch nicht zwischen Angst und Furcht unterschieden. In der Fachliteratur geschieht dies wohl. Sofern die Bedrohung von einem realen Gegenstand ausgeht, spricht man hier von Furcht. Diese ist in der Regel rational begründbar und führt meist zu konkreten Handlungen wie Flucht oder Verstecken. Aber auch Angriff kann eine Furchtreaktion sein. Dagegen ist Angst ein unbestimmtes und beklemmendes Gefühl, das gleichsam von innen kommt und keinen konkreten Anlass benötigt. Davon kündet auch die Etymologie: Das Wort Angst - seit dem 8. Jahrhundert bezeugt - geht auf das indogermanische »anghu« zurück, das »beengt« oder »bedrängend« bedeutet.
Im Deutschen ist daher von Existenzangst, Berührungsangst oder Todesangst die Rede. Engländer sprechen sogar von German Angst. Allerdings kann die Angst vor dem Tod auch eine reale sein, etwa wenn jemand schwer erkrankt ist. Streng genommen müsste es hier Todesfurcht heißen. Wie dieses Beispiel zeigt, sind die Übergänge zwischen Furcht und Angst fließend, was eine strenge Trennung beider oft erschwert oder unmöglich macht.
Evolutionär betrachtet liegt der Sinn von Furcht und Angst auf der Hand: Ein Lebewesen, ob Tier oder Mensch, das furchtlos und ohne Rücksicht auf Verluste agiert, wird häufiger das Opfer von Feinden oder Unfällen als eines, das sich eher furchtsam verhält. Will sagen: Auch wenn Furcht und Angst in unserer Kultur nicht gerade als Tugenden gelten, dienen sie dem Schutz und Überleben von Menschen und bewahren diese vor einem selbstschädigenden Verhalten.
Wie man annehmen darf, fürchteten sich unsere Vorfahren anfangs nur vor realen Objekten, etwa einem in ihrer Nähe befindlichen Raubtier. Aus solcherart Furcht wurde schließlich Vorsicht, die Menschen bewog, eine potenziell bedrohliche Umgebung von vornherein zu meiden. Dies alles blieb der Rationalität geschuldet. Irgendwann jedoch fand ein Umschlag ins Irrationale statt. Das heißt, Menschen entwickelten eine Angst vor Dingen, von denen bei nüchterner Betrachtung gar keine Gefahr ausgehen konnte. Diese Neigung hat sich bis heute erhalten, wie zahllose abergläubische Rituale belegen, aber auch die diffuse Angst vor dem Unbekannten, dem Fremden. Letztere hat nach mehreren Terroranschlägen in Deutschland erheblich zugenommen. Der renommierte Angstforscher Borwin Bandelow erklärt dazu: »Unser Vernunftgehirn hat längst verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, Opfer eines Anschlags zu werden. Auf der anderen Seite gibt es aber ein Angstsystem in unserem Gehirn, das sehr einfach gestrickt ist. In etwa wie das eines Huhns. Das versucht uns Restzweifel einzureden: Was, wenn dieser arabisch aussehende Mann da hinten doch ein Terrorist ist? Und er eine Bombe in seinem Rucksack hat?« Solche Ängste sind schwer zu beherrschen, denn sie entspringen Gehirnregionen, »in denen noch das überlieferte Stammesdenken von vor 100 000 Jahren schlummert«, so Bandelow.
Zwar sind an der Entstehung von Angst verschiedene Hirnregionen beteiligt. Doch es gibt in diesem Netzwerk eine Schlüsselstelle: die sogenannte Amygdala. Sie ist Teil des schon früh in der Evolution der Säugetiere entstandenen Limbischen Systems, dem eine zentrale Funktion bei der Verarbeitung von Emotionen zukommt. Wie aus bildgebenden Verfahren hervorgeht, ist die Amygdala bei allen Angstzuständen aktiv. Auch während des Traumschlafs herrscht hier Hochbetrieb, was erklärt, warum unsere Träume oft eine starke emotionale und angstauslösende Färbung haben. Eine Schädigung der Amygdala führt bei Menschen häufig zu einer deutlichen Reduzierung der Angst und verleitet sie zu einem extrem risikoreichen und draufgängerischen Verhalten.
Normalerweise funktioniert die Amygdala wie eine Alarmanlage. Als solche wird sie von anderen Hirnregionen (Cortex, Hippocampus, Thalamus) mit Informationen aus der Umwelt gespeist. In Millisekunden bewertet sie mittels angeborener und erworbener Mechanismen, ob diese Informationen eine Gefahr signalisieren. Lautet die Entscheidung Ja, sendet die Amygdala Signale an andere Hirnregionen, die die Ausschüttung von Hormonen wie Adrenalin, Dopamin und Cortisol veranlassen. Dadurch wiederum kommt es zu den oben erwähnten Angstreaktionen, die den Körper zugleich in höchste energetische Bereitschaft versetzen.
Häufig jedoch wird ein Reiz aus der Umwelt von der Amygdala falsch bewertet. Zum Beispiel wenn des Nachts ein als bedrohlich wahrgenommener Schatten im Park kein Mensch, sondern nur ein Baum ist. Hier kommt der präfrontale Cortex ins Spiel, ein Teil des Frontallappens des Gehirns, der gegenüber der Amygdala die Rolle einer übergeordneten Instanz einnimmt. Er bewertet ebenfalls das Ereignis und stimmt es mit gehirninternen Erfahrungswerten ab. Liegt ein falscher Alarm vor, unterdrückt er die Angst. Bei vielen Menschen allerdings versagt diese »Bremse«. Statt die Aktivität der Amygdala zu drosseln, wird sie durch den präfrontalen Cortex zusätzlich verstärkt, so dass die individuelle Angstreaktion in Bezug auf die reale Bedrohungslage als weit übertrieben erscheint. In einem solchen Fall sprechen Mediziner von einer Angststörung. Oder einer Phobie, sofern sich die Betroffenen übermäßig vor konkreten Gegenständen, Lebewesen oder Situationen ängstigen. Beispiele hierfür wären: die Angst vor Spinnen (Arachnophobie), die Angst vor engen Räumen (Klaustrophobie) und die Angst, das Haus zu verlassen (Agoraphobie). Mitunter genügt es schon, sich die gefürchtete Situation vorstellen, um eine phobische Angst auszulösen. Wer etwa Flugangst hat und weiß, dass er mit der Familie in vier Wochen in den Urlaub fliegen muss, hat bis dahin gewöhnlich keine gute Zeit.
Zur Behandlung von Phobien dient unter anderem eine spezielle Verhaltenstherapie, bei der man die Patienten gezielt mit den Angst auslösenden Reizen konfrontiert. Diese müssen dabei solange ausgehalten werden, bis eine physiologische Gewöhnung eintritt und die Patienten lernen, dass ihre Ängste irrational und überwindbar sind. Die sogenannte Konfrontationstherapie gilt jedoch als seelisch extrem belastend und ist daher ethisch umstritten.
Eine sanftere Methode zur Angstbehandlung hat jetzt ein Team um den Neurowissenschaftler Ben Seymour von der Universität Cambridge entwickelt, das sogenannte Decoded Neurofeedback. Wie die Forscher im Fachblatt »Nature Human Behaviour« (DOI: 10.1038/S41562-016-0006) berichten, führten sie ihre Untersuchungen hierzu an 17 Freiwilligen durch, bei denen keine Angststörung vorlag. Zunächst wurden den Probanden verschiedenfarbige abstrakte Bilder am Computer präsentiert. Waren diese rot oder grün gefärbt, erhielten die Testpersonen einen kurzen elektrischen Schock. Gleichzeitig wurde bei ihnen das angstassoziierte Aktivitätsmuster im visuellen Cortex des Gehirns aufgezeichnet, das jeweils mit einer Aktivität in der Amygdala einherging. Am Ende des ersten Versuchstages ängstigten sich die Probanden auch ohne Elektroschock vor roten und grünen, nicht aber vor andersfarbigen Bildern. Sie hatten also, wie ihre physiologischen Reaktionen verrieten, eine milde Angststörung entwickelt.
Die mit der Angst verbundene neuronale Aktivität zeigte sich bei den Versuchspersonen sogar dann, wenn sie nicht am Computer saßen, sondern sich nur ausruhten. Offenbar blieben die Angstmuster im Gehirn gespeichert. Das machten sich die Forscher zunutze: Jedes Mal, wenn bei den Probanden ein solches Muster unbewusst auftrat, erhielten diese einen kleinen Geldbetrag, um so möglicherweise die angstbesetzten in positive Erinnerungen umzuprogrammieren. Das Ganze wurde drei Tage wiederholt. Danach konfrontierte man die Probanden erneut mit den roten und grünen Bildern, doch Angstsymptome traten diesmal keine auf. »Weder konnten wir typischen Angstschweiß beobachten noch eine erhöhte Aktivität der Amygdala«, erklärte Seymours Kollegin Ai Koizumi. »Das bedeutet, dass es uns gelungen ist, das Angstgedächtnis unserer Probanden zu löschen, ohne dass sie es überhaupt bemerkt haben.«
Als Nächstes wollen die Forscher ein Archiv von Hirnaktivitätsmustern erstellen, die Dingen entsprechen, vor denen Menschen pathologische Angst haben. Nun wäre es gewiss ein Fortschritt, wenn sich Phobien durch Decoded Neurofeedback erfolgreich behandeln ließen, das heißt ohne Medikamente und die emotionalen Belastungen einer Konfrontationstherapie. Die Ängste von realen Patienten, so Seymour, seien natürlich viel komplexer und stärker ausgeprägt als die im Versuch erzeugten. Dennoch ist er optimistisch, dass es schon bald möglich sein wird, spezifische phobische Ängste wie die vor Spinnen mit der neuen Methode langfristig abzubauen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.