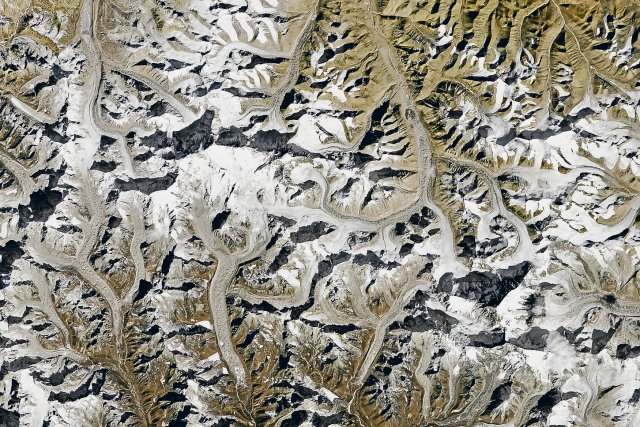- Wissen
- Parasiten und Evolution
Mitleid zählt nicht
Parasiten manipulieren ihre Wirte zum eigenen Vorteil. Doch was man für Arglist halten könnte, ist nur biologisches Programm.
Vieles, was die Evolution in den Jahrmilliarden ihrer Geschichte hervorgebracht hat, ist nichts für zarte Gemüter. Man denke nur an die Gottesanbeterin, eine Fangschrecke, die, wenn sie hungrig ist, dem Männchen bei der Paarung schon mal den Kopf abbeißt. Oder an den König der Tiere, den Löwen. Wenn ein solcher ein neues Rudel übernimmt, tötet er gewöhnlich die Jungen seines Vorgängers, um sich möglichst rasch selbst fortpflanzen zu können.
Das unaufhörliche Fressen und Gefressenwerden in der Natur war für viele Menschen Anlass, an der Existenz Gottes zu zweifeln. Dies tat auch Charles Darwin, der sich im Jahr 1860 in einem Brief an den US-amerikanischen Botaniker Asa Gray dafür entschuldigte, dass er in der Natur keine »Beweise für Zweckbestimmung und Güte« erkennen könne. Es gebe schlicht zu viel Elend auf der Welt, so Darwin weiter. »Ich kann mich nicht dazu überreden, dass ein gütiger und allmächtiger Gott mit Absicht die Schlupfwespen erschaffen haben würde mit dem ausdrücklichen Auftrag, sich im Körper lebender Raupen zu ernähren.«
Die von Darwin angeführten Schlupfwespen gehören zu den sogenannten parasitoiden Insekten, deren Larven häufig in Schmetterlingsraupen heranwachsen. Zu diesem Zweck injizieren befruchtete Schlupfwespen-Weibchen ihre Eier mit Hilfe eines stachelförmigen Legebohrers in den Leib der Raupen. Nachdem die Wespenlarven geschlüpft sind, fressen sie die Raupen von innen her auf. Die lebenswichtigen Organe des Wirts werden dabei geschont, um diesen möglichst lange als lebendige Nahrungsquelle zu erhalten. Anschließend verpuppen sich die Larven unmittelbar neben der Raupe, die in der Folge meist verendet.
Als wäre dies nicht schon gruselig genug, haben Schlupfwespen noch einen weiteren »fiesen« Trick auf Lager. Denn das Immunsystem der Raupe hätte eigentlich die Möglichkeit, die Eier der Parasiten abzutöten. Deshalb nehmen die Wespen die Hilfe sogenannter Polydna-Viren in Anspruch, welche sie massenhaft zusammen mit den Eiern übertragen. Die Viren, die in das Genom der parasitierenden Schlupfwespen integriert sind, sorgen dafür, dass die Abwehrkräfte der Raupe rasch erlahmen.
Das Wort »Parasit«, das aus dem Altgriechischen stammt (para = ne᠆ben; sitos = gemästet), bezeichnete ursprünglich einen Vorkoster bei Opferfesten, der dadurch ohne Leistung zu einer Speise kam. In der Biologie versteht man unter Parasitismus den Nahrungserwerb zu Lasten eines in der Regel größeren Wirtsorganismus. Dieser wird dabei häufig schwer geschädigt, aber nur selten getötet. In der Natur ist Parasitismus weit verbreitet. Biologen gehen davon aus, dass rund 40 Prozent aller Arten auf der Erde Parasiten sind, von denen manche den Übergang von der eigenständigen zur schmarotzenden Lebensweise gleich mehrfach vollzogen haben.
Die Ursprünge des Parasitismus reichen mindestens 50 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück. Das belegt ein Stück Bernstein, das an der russischen Ostseeküste gefunden wurde. Es konserviert eine Ameise, an deren Kopf sich eine blutsaugende Milbe klammert. »Diese bemerkenswerte Entdeckung liefert den ältesten Beleg für eine intime - und wahrscheinlich parasitische - Beziehung zwischen mesostigmatischen Milben und sozialen Insekten«, sagt der britische Paläontologe Jason Dunlop, der den Fund am Berliner Naturkundemuseum ausgewertet hat. Fossilien der entdeckten Art sind bis heute rar. Dafür gibt es eine Erklärung: Ameisenliebende Milben meiden die Rinde von Bäumen, weswegen es sehr selten passiert, dass sie vom Baumharz eingeschlossen werden.
Parasiten gelten als in hohem Maße spezialisierte Lebewesen. Auf Viren trifft diese Beschreibung nicht zu, denn sie besitzen keinen eigenen Stoffwechsel. Dennoch rechnen manche Wissenschaftler auch Viren zu den Parasiten, da sie ebenfalls einen Wirtsorganismus befallen und dessen Zellmaschinerie für ihre eigene Vermehrung nutzen. Dabei wird der Wirt häufig zu bemerkenswerten Verhaltensänderungen genötigt.
Einige Viren greifen zu diesem Zweck unmittelbar in das Erbgut ihrer Opfer ein. Wie das sogenannte Baculovirus, das die Raupen eines verbreiteten Baumschädlings, des Schwammspinners, infiziert. Hierbei manipuliert das Virus ein Gen, das für ein Enzym mit der Bezeichnung EGT kodiert. Das Enzym wiederum schaltet ein Hormon aus, das den Raupen Sättigung signalisiert. Diese fressen daher unaufhörlich weiter und gelangen bei der Suche nach Nahrung bis auf die Wipfel der Bäume, auf denen sie leben. Nun leitet das Baculovirus das Finale ein. Sprich, es tötet die Raupe und sorgt dafür, dass sie sich regelrecht verflüssigt. Die in ihr verborgenen Viren tropfen anschließend auf die Umgebung herab und infizieren neue Schwammspinner. Das Spiel kann von vorn beginnen.
Auch Würmer beherrschen die Kunst der Manipulation. Welche Kniffe sie dabei anwenden, haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön anhand des Bandwurms »Schistocephalus solidus« untersucht. Die Larven dieses Modellparasiten schwimmen frei im Wasser umher, bis sie irgendwann von einem Ruderfußkrebs gefressen werden. In dessen Leib reifen die Larven ungefähr zwei Wochen, dann ist es für ihr weiteres Wachstum unerlässlich, den Wirt zu wechseln. Das aber bedeutet: Der Krebs muss von einem anderen Tier verspeist werden. Und zwar von einem Dreistacheligen Stichling. Nur in diesem Fisch können sich die Larven weiter entwickeln, in jedem anderen Fisch würden sie verenden. Um den nötigen Wirtswechsel einzuleiten, verändern die Bandwurmlarven durch chemische Signale das Verhalten des Krebses so, dass dieser sich dem Stichling regelrecht präsentiert. Und der schnappt begierig zu.
Nachdem die Wurmlarven im Körper des Stichlings weiter an Größe zugelegt haben, heißt es für sie erneut warten. Warten darauf, dass der Stichling von einem Vogel, zum Beispiel einem Reiher oder Kormoran, gefressen wird. Denn nur im Verdauungstrakt eines Warmblüters, in dem Temperaturen von mindestens 38° C herrschen, können die Larven ihre Entwicklung zu geschlechtsreifen Würmern vollenden und sich paaren. Die Wurmlarven blockieren daher den Fluchtreflex des Stichlings, so dass der Fisch zur leichten Beute eines Vogels wird. Nach der Paarung im Körper des Vogels gelangen die Eier mit dessen Kot ins Wasser, wo die nächste Generation von Bandwurmlarven alsbald darauf hofft, einem hungrigen Ruderfußkrebs zu begegnen, um erneut ihr biologisches Programm abspulen zu können.
Es gibt zahlreiche Hinweise, dass auch Menschen von Parasiten manipuliert werden. Im Verdacht steht unter anderem der Einzeller »Toxoplasma gondii«. Dessen Endwirt ist die Katze, nur in ihr kann er sich sexuell vermehren. Zwar setzen Katzen eine Art Sporen der Parasiten über ihren Kot frei. Da sie den aber selbst nicht fressen, hätte sich der Parasit in eine Sackgasse manövriert, denn der Weg zur nächsten Katze bliebe ihm versperrt. Doch zu seinem Glück gelangen die Sporen über kleineres Getier auch in die Mägen von Mäusen. Werden diese von Katzen gefressen, kann der Zyklus von Neuem beginnen. Bekanntlich tun Mäuse aber alles, um nicht zur Beute einer Katze zu werden. Offenkundig »weiß« das auch der Parasit: Hat er sich erst einmal im Körper einer Maus festgesetzt, programmiert er deren Gehirn so um, dass sich die kleinen Nager - wider ihre Natur - von Katzengeruch magisch angezogen fühlen. Das heißt, statt zu flüchten, laufen sie direkt in die Krallen ihrer Feinde.
Auch rund ein Drittel aller Menschen tragen »Toxoplasma gondii« in sich. Denn nach einer oft beschwerdefrei verlaufenden Toxoplasmose-Infektion - etwa durch den Verzehr von kontaminiertem Schweinefleisch - überdauern die Erreger als Zysten im Gehirn und in den Muskeln ihrer Wirte. Heute ist der Mensch für die Parasiten natürlich ein Fehlwirt, denn er wird nur selten das Opfer von Angehörigen der Katzenfamilie. Das sei früher anders gewesen, meint der tschechische Biologe Jaroslav Flegr. Da seien Menschen häufiger von Raubkatzen gejagt und erlegt worden. Ausgehend davon entwickelte er die These, dass der Toxoplasmose-Erreger auch im menschlichen Gehirn Verhaltensänderungen bewirkt, die heute aber sinnlos sind. Für die meisten Parasitologen schien dies zunächst unvorstellbar. In den letzten Jahren konnte Flegrs These jedoch durch verschiedene Untersuchungen gestützt werden.
Dabei zeigte sich, dass die uns nahe verwandten Schimpansen eine besondere Vorliebe für Leopardenurin entwickeln, wenn sie von Toxoplasma befallen sind. Unter den Großkatzen sind Leoparden die Hauptfeinde der Schimpansen. Löwen hingegen stellen für die Affen keine solche Bedrohung dar. Und tatsächlich lässt Löwenurin Schimpansen kalt. In einer weiteren Untersuchung kam heraus, dass mit Toxoplasma infizierte Menschen, genauer gesagt Männer, zu einem risikoreichen Verhalten neigen, aber zugleich in ihren Reaktionen verlangsamt sind. Mithin könnten jene unserer männlichen Vorfahren, die den Erreger in sich trugen, durch ihr verändertes Verhalten zur leichteren Beute von Raubkatzen geworden sein, in deren Körper sich der Einzeller erneut vermehrte. Noch freilich haftet Flegrs Theorie viel Spekulatives an, zumal niemand weiß, über welche biochemischen Prozesse Toxoplasma das menschliche Gehirn zu beeinflussen vermag.
Obwohl die Strategie des Parasitismus weit verbreitet ist, taugt sie nicht zur Deutung sozialer Vorgänge. Gerade die deutsche Geschichte sollte uns hier eine dringliche Mahnung sein: Im Dritten Reich rechtfertigten die Nazis die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden unter anderem mit dem perfiden Argument, diese seien »Parasiten am gesunden deutschen Volkskörper«. Heute sprechen Politiker eher von (Sozial-)Schmarotzern, die sich angeblich eines parasitären Verhaltens bedienten und statt selbst zu arbeiten auf Kosten anderer lebten. Eine solche Aussage ist schon aus biologischer Sicht widersinnig, da sich Parasitismus per definitionem nur zwischen verschiedenen Arten vollzieht. Gleichwohl findet der Ansatz, soziale Prozesse mit biologischen Metaphern zu beschreiben, noch immer viele Befürworter. Ein unrühmliches Beispiel lieferte 2002 der damalige US-Präsident George W. Bush, als er in seinem Bericht zur Lage der Nation von Terroristen als Parasiten sprach, die es auszurotten gelte. Von Donald Trump sind ähnliche Äußerungen nicht überliefert. Bisher nicht.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.