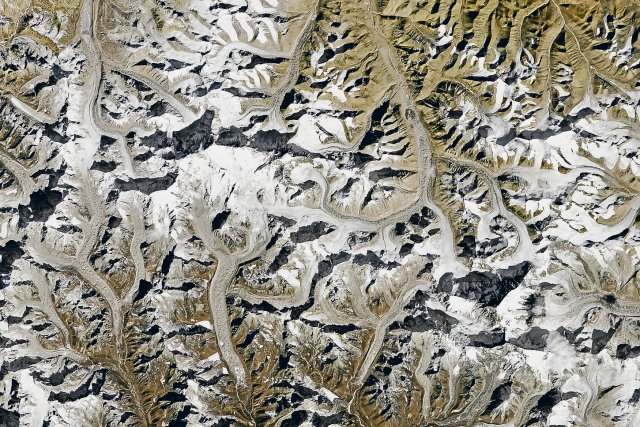- Wissen
- Karl-Marx-Hof in Wien
Gebaut für den Neuen Menschen
Der Karl-Marx-Hof ist eine Ikone des Roten Wien, wegweisendes Gemeindebauprojekt und Schlüsselbau der Moderne

Unter den europäischen Städten hat eine Großstadt es scheinbar zuwege gebracht, dem neoliberalen Zeitgeist der 1990er und 2000er Jahre zu widerstehen und ihren Bestand kommunaler Wohnungen nicht zu privatisieren. Dass Wien diese Stadt war, könnte auf den ersten Blick überraschen. Bis 2024 wurde die Hauptstadt Österreichs von der Beratungsagentur Mercer regelmäßig zur Stadt mit der größten Lebensqualität gekürt, sie ist voll mit teuren Prestigebau-Projekten und (oft unbewohnten) Anlegerwohnungen. Doch Wien steht im internationalen Städtevergleich außerdem bis heute für relativ leistbaren Wohnraum. Es gibt einen wichtigen historischen Grund dafür, warum sich Wien gegen Privatisierungswellen und Immobilienpreise wie in München, Hamburg oder Paris relativ gut behaupten konnte: Mit Unterbrechung durch faschistische Regierungen ist die Stadt seit gut 100 Jahren sozialdemokratisch regiert, zum ersten Mal 1919, als die SDAP, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die absolute Mehrheit errang.
Die Stellung Wiens als eigenes Bundesland seit 1920 erweiterte die Handlungsräume beträchtlich und ermöglichte nicht nur eine gewisse Unabhängigkeit bei politischen Schwerpunktsetzungen, sondern vor allem eine selbstständigere Steuerpolitik. Diese bedeutete eine Umschichtung der Steuerlast von Massen- auf Besitzsteuern und setzte sich aus »Luxussteuern« und der zweckgebundenen progressiven Wohnbausteuer auf Mietobjekte zusammen. »Erbaut von der Gemeinde Wien in den Jahren 1927–1930 mit den Mitteln der Wohnbausteuer« – steht so oder ähnlich in Relief-Lettern sichtbar auf den meisten Gemeindebauten und verkündet stolz, womit das Bauprogramm finanziert wurde. Für die Architekturtheoretikerin Gabu Heindl markiert die Schrift das »Versprechen einer zu bauenden Welt« und ist eine Art Kampfansage an die Gegner*innen, insbesondere das Kapital, dem so erfolgreich ein Anteil am gesellschaftlichen Reichtum streitig gemacht werde.
Dank dieser neuen politischen und finanziellen Macht wurde das Rote Wien – das knapp 15 Jahre bestand, bis es 1934 von der austrofaschistischen Regierung zwangsweise beendet wurde – zum Inbegriff eines sozialdemokratischen Experiments des Austromarxismus. Das Rote Wien begeisterte überzeugte Sozialist*innen ebenso wie zahlreiche Intellektuelle, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen. Viele von ihnen waren Frauen und nicht wenige jüdischer Herkunft.
Der »liegende Riese«
Im Rahmen dieses sozialen, kulturellen und pädagogischen Projekts stellten die Reformer*innen die Frage »Wie leben?« ins Zentrum. Sie wollten durch die Umgestaltung von Lebens-, Arbeits- und Wohnräumen egalitäre(re) Formen des Zusammenlebens realisieren und gesellschaftliche Erneuerung ermöglichen. Dementsprechend kam neben – und verbunden mit – Bildungs- und »Fürsorgemaßnahmen« dem Wohnbauprogramm eine zentrale Rolle zu. Auf Grundlage der konsequent umverteilenden Fiskalpolitik wurden mehr als 60 000 Wohnungen und zahlreiche Sozial-, Gesundheits-, Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtungen geschaffen. Die sichtbarsten Zeugnisse des Roten Wien sind die etwa 380 Wiener Gemeindebauten, als deren ikonischer Vorzeigebau der kilometerlange Karl-Marx-Hof gilt. Geplant vom Architekten Karl Ehn, einem Schüler Otto Wagners, wurde die riesige Wohnanlage im Oktober 1930 von Bürgermeister Karl Seitz eingeweiht.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Der Karl-Marx-Hof liegt am Rand des bürgerlichen Bezirks Döbling, getrennt durch eine Bahntrasse und den Donaukanal vom Arbeiter*innenbezirk Brigittenau. Er umfasst ein langes, schmales Grundstück inklusive Querstraßen, die die Wohnungen mittels Passagen unterqueren. Meistens vierstöckig, ist nur das imposante Hauptgebäude sechs Stockwerke hoch, mit breiten Torbögen als Fußgängerdurchgänge. Sie gewähren bis heute großen Menschenmengen den Zugang vom Bahnhof Heiligenstadt zum damals wichtigsten Wiener Fußballstadion Hohe Warte. Während die Grünanlage mitten im Gemeindebau zur Heiligenstädter Straße hin offen ist, verbindet das Hauptgebäude zwei Wohnanlagen, die zwei lange, breite, begrünte Innenhöfe umzingeln. In jedem befinden sich ein frei stehender Kindergarten und ein weiterer Bau mit Wäscherei- und Bäderanlagen sowie Gemeinschaftsräume; entlang der Heiligenstädter Straße sind Geschäfte im Erdgeschoss eingemietet.
Kontroversen um die neue Architektur
Karl Ehn wurde oft vorgeworfen, sein Entwurf wirke imperialistisch. Schon 1926 verspottete Architekt Josef Frank die Gemeindebauten als »Volkspaläste«. Seine Kritik meinte wohl auch Elemente wie den gelben Anstrich nach dem Vorbild des Schlosses Schönbrunn und die Ornamentik des Karl-Marx-Hofs. Denn das Hauptgebäude verfügt über vier rote Türme, die jeweils mit einem futuristisch anmutenden Fahnenmast gekrönt sind. Auf den Bögen, wo im adeligen Stadtpalais das Familienwappen angebracht ist, hängen Skulpturen, die sozialistische Ideale personifizieren. Lampen und Treppengeländer sind in Art-Deko-Pracht gestaltet (nachgemachte Karl-Marx-Hof-Leuchter kann man heute für 6000 Euro kaufen), die Torgitter und Pforten wirken fast ritterlich. Architekturkritiker*innen der Nachkriegsmoderne beschimpften die Gemeindebauten oft als »bürgerlich«, weil sie die Blockrandbebauung der Monarchie wieder heraufbeschwören würden, statt neue Formen wie den Wolkenkratzer zu wählen. Ehns »liegender Riese«, so auch Architekturhistoriker Helmut Weihsmann, sei nicht »modern« genug, er versäume die technologische Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit, die den Hochbau in den Zwischenkriegsjahren so beliebt gemacht haben.
Andere, wie die Architekturhistorikerin Eve Blau, verteidigen den Karl-Marx-Hof. Die lockere Bebauung und das Design bewirkten ganz anderes als Herrschaftsbauten und bürgerliche Mietshäuser. Auch die geringe Wohnungsgröße, die schon in den 1920ern kritisiert wurde, sei nicht nur wirtschaftlichem Mangel und der Notwendigkeit, schnell möglichst viel Wohnraum zu schaffen, geschuldet. Dahinter steht auch der Gedanke, dass Wohnen und Leben nicht an der Wohnungstür enden: Die Eingänge der Stiegen öffneten sich in die Innenhöfe mit den Kollektiveinrichtungen – Kindergärten und Wäschereien, Badeanlagen, Bibliotheken, Wohn- und Mütterberatungsstellen. Sie erweiterten den privaten Raum und verlängerten ihn in die Stadt beziehungsweise den halböffentlichen Raum des Gemeindebaus. So entstanden Orte, an denen soziale Verbindungen geschlossen werden können.
Diese dienten nicht nur nachbarschaftlichem Austausch, sondern sollten Knotenpunkte sein, die zur Veränderung der Wiener*innen zu sozialistischen »Neuen Menschen« beitragen sollten. In seinem gleichnamigen Buch von 1924 erklärte der Sozialphilosoph Max Adler, wie die »sozialistische Erziehung« vonstattengehen sollte: »Die Menschen ändern sich erst und nur mit ihren Lebensverhältnissen. Will man also neue Menschen, so müssen erst die alten Lebensformen und -zustände weggeschafft werden.« Nicht nur neue Wohnungen, Schwimmbäder oder Gesundheitsmaßnahmen, sondern auch ein umfassendes Bildungsprogramm für alle sollten dafür sorgen.
Ein Sozialismus des Bürgertums?
Viele der Gemeindebauten tragen die Namen internationaler sozialistischer Stars wie der Karl-Marx- und der Lassalle-Hof, der Matteotti- oder Robert-Blum-Hof. Andere Namen aber deuten auf den hohen Stellenwert eines aufklärerisch-bürgerlichen Bildungsideals im Roten Wien hin, wie der Heine-, der Goethe- oder der nach dem Schweizer Aufklärer und Pädagogen benannte Pestalozzi-Hof. Auch die neuen Arbeiterbibliotheken enthielten zahlreiche Goethe- und Schiller-Ausgaben. Die Ausleihstatistiken belegten jedoch, dass nicht wenige eher zur Unterhaltungsliteratur griffen und viele auch lieber ins Kino gingen, anstatt Arbeitersymphoniekonzerte zu besuchen.
In vielem vertraten die Reformer*innen sehr progressive, teils bis heute nicht umgesetzte Vorstellungen einer modernen Gesellschaft, zugleich agierten sie oft paternalistisch. Das äußerte sich auch in der Idee der Geschmackserziehung. Die Arbeiter*innen sollten modern werden und ihre oft klobigen verschnörkelten Möbelstücke aus den neuen Gemeindewohnungen verbannen. In einer abgerundeten Schaufensterfront am südlichen Ende des Karl-Marx-Hofs errichtete der Österreichische Verband für Wohnungsreform (ÖVW) deshalb eine Lehreinrichtung, die Geschmack und Produktivität der Arbeiter*innenklasse durch moderne, rationale Wohnungsgestaltung steuern sollte – darin dem Deutschen Werkbund nicht unähnlich. In der BEST, der Beratungsstelle für Inneneinrichtung und Wohnhygiene, stellten Designer*innen Modellwohnungen zusammen, die den Arbeiter*innen minimalistische Mehrzweckmöbel nahebringen sollten. Zusätzlich gab es Veranstaltungen mit Vorträgen und Lichtbildern. Wie beim Neuen Frankfurt waren zum Teil Frauenvereine mit eingebunden, was zeitgenössisch mitunter als weibliche »Ergänzung« der kreativen Köpfe abgetan wurde: »Der Architekt denkt, die Hausfrau lenkt«, erklärte der deutsche Architekt Bruno Taut beispielsweise. Die Idee einer egalitären Gesellschaft geriet, vor allem wenn es um eine Gleichheit der Geschlechter ging, auch an ihre Grenzen.
Emanzipation und Mehrfachbelastung
»Wir hatten ein Wohnzimmer, ein kleines Schlafzimmer, eine kleine Küche, eine Dusche und einen Balkon. Es gab eine zentrale Waschküche, die erst ganz allmählich allgemeiner in Gebrauch genommen wurde. Viele Frauen scheuten sich, den heruntergekommenen Zustand ihrer Bett- und Unterwäsche etwaigen kritischen Blicken auszusetzen. Es gab auch eine Leihbibliothek. Ich war an zwei Abenden in der Woche dort, gab Bücher aus, empfahl Bücher, die ich lesenswert fand, schloss Freundschaften und gewann Parteimitglieder.« So beschreibt die Sozialforscherin Marie Jahoda (»Die Arbeitslosen von Marienthal«, 1932) ihr Leben im Karl-Marx-Hof. Etwa seit der Eröffnung bis zu ihrer Verhaftung 1934 wohnte sie hier, meistens mit ihrem Mann Paul Lazarsfeld und Tochter Lotte. In Jahodas Erinnerung bedeutete das Leben im Karl-Marx-Hof funktionale, lebenswerte Wohnungen (allerdings ohne Duschen, eine Tatsache, die schon damals für Kritik sorgte), die erweitert wurden um Gemeinschaftseinrichtungen.

Jahoda hatte studiert, war von Jugend an in sozialistischen Organisationen aktiv, berufstätig, zugleich verheiratet und Mutter. Sie ist ein Beispiel für die vielen Frauen, die aktiv die Reformen mitgestalteten, wie Käthe Leichter oder Adelheid Popp. Zugleich entsprach sie der (sozialdemokratischen) neuen Frau: Jung, berufstätig, sexuell selbstbestimmt, sich ehemalige Männerdomänen aneignend, sportlich, mit Bubikopf und kurzem Rock, politisch engagiert, berufstätig, (bald) verheiratete Kameradin und Mutter – so wurde sie in Gedichten, Filmen, auf Fotos oder Wahlplakaten visualisiert.
Realiter war sie immer mehrfach belastet und zusätzlich zur Lohnarbeit zuständig für Kinder und Haushalt. Das deutet Marie Jahoda in ihren Erinnerungen an und wird vor allem in dem semi-dokumentarischen Film »Frauenleben – Frauenlos« (1931/32) ersichtlich. Dieser zeigt recht realistisch den gehetzten Tagesablauf einer Holzarbeiterin mit Mann und zwei Kindern zwischen Fabrik, Care-Arbeit sowie politischem Engagement und setzt die Ergebnisse der qualitativen Studie »So leben wir« quasi in Bilder um. Diese von der Sozialwissenschaftlerin Käthe Leichter und ihrem Frauen-Netzwerk für die Wiener Arbeiterkammer durchgeführte Untersuchung beruht auf 1320 ausgewerteten Fragebögen und qualitativen Interviews und erhebt Arbeitsverhältnisse, Lebensgestaltung, Ängste und Wünsche von Wiener Industriearbeiterinnen. Ein zentraler Punkt sind Wohnverhältnisse und die Mehrfachbelastung durch Hausarbeit und Kinderbetreuung. Eine der interviewten Arbeiterinnen brachte das so auf den Punkt: »Für die Frauen ist zu Hause nur Schichtwechsel!« Käthe Leichter resümierte: »Der ›zweite‹ Arbeitstag der Arbeiterin wird im Haushalt verbracht.« Wenn überhaupt, wurden sie von ihren Töchtern, anderen weiblichen Verwandten oder Nachbarinnen unterstützt.
Der neue Haushalt
Das Rote Wien wollte die Entlastung der Frauen durch Zentralisierung und Rationalisierung, Auslagerung oder gemeinschaftliche Organisation erreichen. Hausarbeit sollte als Arbeit anerkannt und entlohnt werden. Bewusstseinsbildung für eine Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung zwischen Frauen und Männern war nicht das Ziel, nur wenige (auch wenige Frauen) kritisierten die geschlechtsspezifische Zuschreibung der Care- und Reproduktionsarbeit.
Die Küche war jener Raum, in dem die Debatten um Modernisierung, Ökonomie, Frauenemanzipation und die Haushaltsreform ausgetragen wurden – im Roten Wien wie in ähnlichen Reformprojekten. Die international geführten Diskussionen und architektonischen Entwürfe fokussierten Rationalisierung durch veränderte Grundrisse, funktionale Möbel, minutiös geplante Arbeitsschritte. Manchmal wurden reine Arbeitsküchen, ähnlich der von Margarete Schütte-Lihotzky entwickelten »Frankfurter Küche« in die Wiener Gemeindewohnungen eingebaut, häufiger Arbeits-Wohnküchen mit einem Esstisch.
Wäschereien und Kindergärten, von denen es im Karl-Marx-Hof bis heute zwei gibt, sollten wie die Küchen die Mehrfachbelastung verringern. Die meisten von Leichter befragten Arbeiter*innen begrüßten die neuen Kindergärten und Horte, trotzdem nutzten relativ viele sie nicht. Nicht nur wegen Vorurteilen, wie heute waren oft tatsächliche Hürden ausschlaggebend: nicht an Arbeitszeiten angepasste Öffnungszeiten und zu große Entfernungen zu Wohn- beziehungsweise Arbeitsort.
Die beiden Waschküchen im Karl-Marx-Hof waren modern ausgestattet und ermöglichten eine Teilmechanisierung und Rationalisierung des Waschvorgangs. Doch da pro Wohnung monatlich nur ein fixer Tag vorgesehen war, empfanden viele trotz der Maschinen den Waschtag als Belastung. Die Waschküchen waren zudem gendered spaces. Dass Frauen hier (weitgehend) unter sich blieben, muss nicht unbedingt als Nachteil gelten – Stichwort safe space. Die Waschküchen wurden jedoch von einem Waschmeister betreut, der die Abläufe beaufsichtigte und kontrollierte, und damit ein männliches Disziplinarregime eingeführt. Das schloss nicht nur die Möglichkeit zur Selbstorganisation aus, sondern versteckte auch einen relevanten Teil der Hausarbeit. Wie der Waschtag waren die meisten Maßnahmen zur Reduktion der Care- und Reproduktionsarbeit von einem Spannungsverhältnis zwischen der Verbesserung der Lebensverhältnisse von Frauen und der Verfestigung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung geprägt. Nur vereinzelt wurde infrage gestellt, dass Frauen für den Haushalt zuständig waren.
Leichters Studie zeigt auch, dass das Leben in der Kleinfamilienwohnung mit Mutter-Vater-Kind(ern) nicht die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse in der Arbeiter*innenschicht spiegelte: Viele der Frauen gaben an, bei den Eltern zu leben, auch mit Partner oder Kindern, andere wohnten in Untermiete. Zudem gab es viel mehr ledige Frauen als heute meist angenommen, von den interviewten unverheirateten Frauen verfügte nur ein Drittel über eine eigene – kleine – Wohnung. Der Bedarf an Kleinstwohnungen für Einpersonenhaushalte war also weit höher, als die Bauprojekte vermuten lassen. In den Gemeindebauten gab es in Restflächen einige – doch viel zu wenige – Einzimmerwohnungen, im Karl-Marx-Hof waren es 88 von insgesamt 1382 Wohnungen. Die Stadtplanungs- und Wohnbaupolitik des Roten Wien half also mit, die Kleinfamilie als normatives Modell gesamtgesellschaftlich zu fördern, die in den 1950er/1960er Jahren in Österreich schließlich dominierte.
Der Karl-Marx-Hof nach dem Roten Wien
Die Wiener Sozialdemokratie nach 1945 hat das Erbe des Roten Wien zum Teil weitergeführt und ausgebaut (siehe die Justiz-, Familienrechts- und Bildungsreform Bruno Kreiskys und seiner Mitstreiter*innen in den 1970ern). Schon 1947 wurde das Wohnbauprogramm wieder aufgenommen und insgesamt mehr als 100 000 neue Gemeindewohnungen errichtet. Wohl nicht zufällig 1990 wurde es gestoppt und später sogar einzelne Gemeindebauten im teuren Stadtzentrum an Private verkauft. Doch seit Kurzem ist die Notwendigkeit leistbaren Wohnraums in einer der in der EU am stärksten wachsenden Großstädte wieder politisch opportun und es werden neue Projekte realisiert.
Der kommunale Wohnbau verteilt sich über alle Bezirke und führt so zu weniger räumlicher Segregation als in vergleichbaren Großstädten. Mit der durch eine EU-Richtlinie erzwungenen Öffnung der Wohnungen für Nicht-Österreicher*innen 2006 veränderte sich einiges. Statt einer tendenziell überalterten Klientel zogen wieder mehr Familien ein und belebten die Anlagen – manche Alt-Mieter*innen jedoch wollten das Grundrecht auf leistbares Wohnen nicht teilen. Schon im Roten Wien hatte das Vergabesystem für Gemeindewohnungen Menschen bevorzugt, die schon länger in der Stadt lebten, und die während oder nach dem Krieg Zugezogenen – viele davon jüdischer Herkunft – tendenziell ausgegrenzt. Das hatte einerseits pragmatische Gründe, zeigt andererseits, dass schon unter den Reformer*innen im Roten Wien solche waren, die für Wähler*innenstimmen in Kauf nahmen, Abstriche zu machen bei ihrem programmatischen Anspruch, allen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Sprechende Steine
Bei der Einweihung des Karl-Marx-Hofs am 13. Oktober 1930 erklärte der sozialdemokratische Bürgermeister Karl Seitz feierlich: »Wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen.« Um die Steine aufs Neue sprechen zu lassen, besuchten wir vor einigen Wochen den berühmten Gemeindebau. Die riesigen Bögen und die ikonischen, repräsentativen Fassaden wirken immer noch bombastisch, aber es sind uns auch andere Details aufgefallen, vor allem die vielen Balkons. Eine Mitarbeiterin des Museums in der Anlage erklärte uns, dass heute die Wohnungen genau deshalb, nicht wegen der Geschichte des Gebäudes so begehrt sind. In einem der Höfe kamen wir mit einem Bewohner ins Gespräch, der auf seinem Balkon werkelte. Der Rentner, ursprünglich aus Serbien, zeigte stolz auf seine Oleandertöpfe und Feigenbäume, die unter seiner Obhut den Wiener Winter überstanden hatten.
Hinter einem der beiden Kindergärten trafen wir eine ältere Frau, die uns erklärte, warum man schon im Februar Knoblauchknollen aussetzen sollte. Sie deutete auf ihre Wohnung, die sich in einem Teil des Karl-Marx-Hofs befindet, der in den Februarkämpfen 1934 zwischen sozialdemokratischen Verteidiger*innen und der austrofaschistischen Staatsmacht große Schäden bekam und seitdem für ikonische antifaschistische Bilder sorgt.
Bleibt in diesen Wohnungen noch etwas von den Visionen des Neuen Menschen? Als Kulturhistoriker*innen stellten wir ihr die Frage, wie es sich im Karl-Marx-Hof leben lässt. Die Rentnerin, auch sie migrantisch, gab uns zur Antwort: Hier sei das Leben mittelmäßig, am besten sei es immer in der Heimat. Wir wollten Architekturkritik üben, stattdessen trafen wir auf eine komplexe persönliche Erfahrung. Sie lobte die Wohnung nicht aufgrund von Hofbegrünung oder Wohnraumgestaltung, sondern die Lage, denn der Karl-Marx-Hof sei nicht weit von dem Haus und Garten ihres Sohnes. Neue Menschen? Eher nicht. Aber ganz schön menschlich.
Marie-Noëlle Yazdanpanah ist Kulturhistorikerin in Wien. Sie ist Mitglied des Forschungskollektivs Einküchenhaus und arbeitet zu Visueller Kultur, Stadtgeschichte und Genderforschung.Rob McFarland ist Kulturwissenschaftler und Professor für Humanities an der Brigham Young University (USA) und Herausgeber des Red Vienna Sourcebook.
Beiträge der Autor*innen erschienen auch im Sammelband Cara Tovey/Julian Klinner (Hg.): Karl-Marx-Hof. Schlüsselbau der Moderne. Eine Publikation des Forschungsnetzwerks BTWH (Berkeley/Tübingen/Wien/Harvard). Mandelbaum-Verlag 2024, 260 S., br., 25 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.