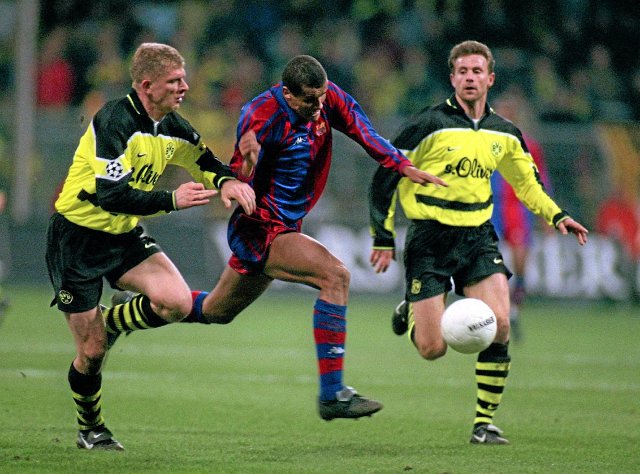Morgen startet der 35. GutsMuths-Rennsteiglauf. Er ist - sieht man vom Berlin-Marathon ab - mit rund 15 000 Teilnehmern der größte ostdeutsche Lauf. Und er ist zudem die größte DDR-Sportveranstaltung überhaupt, die sich in die Bundesrepublik hinüberretten konnte. Ein Grund dafür war dem Lauf in die Wiege gelegt: basisgetragenes, kluges bis pfiffiges bürgerschaftliches Engagement.
Praktisch begann alles am 13. Mai 1973 um 7 Uhr an der Hohen Sonne bei Eisenach. Rund 100 Kilometer hatten sich vier Laufenthusiasten der Jenenser Uni auf dem Kamm des Thüringer Waldes vorgenommen: die Mathematikstudenten Hans-Joachim Römhild und Wolf-Dieter Wolfram, der Sportstudent Jens Wötzel und Hans-Georg Kremer, der bereits bei Prof. Dr. Willi Schröder als sportwissenschaftlicher Assistent arbeitete. Nach knapp zehn Stunden war das Abenteuer dann zu Ende. Ein Reporter der »Volkswacht« aus Gera notierte als Antwort auf die Frage, ob und wann die vier sich denn dieser Tortour noch einmal unterziehen wollten: »Nächstes Jahr im Mai.« Dabei ist es geblieben. Der Rennsteiglauf (Hauptdistanzen 72,2, 43,1 und 21,1 km) gilt heute als der größte und härteste Cross Europas. »Er konnte sich gegen die Konkurrenz vieler anderer Laufveranstaltungen behaupten und ist inzwischen auch zu einem gesamtdeutschen Klassiker gereift«. So sieht es Jürgen Lange, Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins, vor dem sonnabendlichen 35. Jubiläum, das bereits am Freitag mit einem Forum in Oberhof eingeleitet wird. Diese Bilanz ist um so erstaunlicher, da es sich ja ursprünglich um ein enthusiastisches »östliches« Unterfangen handelte, dass ausschließlich von Idealen und nicht wie die »westlichen« Stadtmarathons wesentlich von einer Geschäftsidee getragen war. Dass die Thüringer Organisatoren anders als die anderer großer DDR-Sportveranstaltungen nach der Wende 1989/90 die Kurve kriegten, hat zwei Gründe: regionale Verankerung der Laufes und seine, heute würde man sagen: basisdemokratischen Organisationswurzeln. Die vier jungen »Väter« von 1973 hatten mit ihrer sportlichen Vision zwar den Zeitgeist der Läuferszene getroffen, nicht aber die Intention der DDR-Sportführung. Solche abenteuerlichen Distanzen passten nicht ins brave zentrale Konzept des organisierten Freizeizeitsports, für den in den 70er Jahren das Motto »Eile mit Meile« galt. Manfred Ewald, Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes, befand deshalb 1975, dass es für den Rennsteiglauf »keine sportpolitische, sportliche oder sportmedizinische Notwenigkeit« gebe. »Die DDR braucht keinen zweiten Wasalauf.« Meistens bedeuteten solche Bemerkungen in der DDR das Aus für Ideen, die sich außerhalb zentraler Vorgaben bewegten. Gar nicht so selten wurde indes von den jeweils Betroffenen in Wirtschaft oder Kultur, in Wissenschaft oder eben auch im Sport die Grauzone zwischen Verdikt und stillschweigender Duldung zur Eigeninitiative genutzt. Die Rennsteigläufer verzagten nicht, sondern putzten von Anfang an regionale Klinken, warben für ihre Idee Mitstreiter, heute würde man sagen: Sponsoren. Sie stießen dabei auf Borniertheit, viel mehr aber auf offene Ohren. Bald machten Genossen der SED-Bezirksleitung, örtliche Polizeidienststellen und DTSB-Funktionäre ebenso mit wie von Anfang an die Jenaer Universität. Es ging um Papierkontingente und Buskapazitäten, um Verpflegung oder auch nur um öffentliche Anerkennung für die alljährlich tausenden ehrenamtlichen Helfer. So gesehen wurde der Rennsteiglauf in der DDR zum größten »Schwarzbau« auf sportlichem Gebiet. Und wie bei den meisten solcher »Schwarzbauten«, also bei Initiativen und Investitionen an Plänen und Bilanzen vorbei, war da nicht etwa Anti-DDR-Gefühl im Spiel. Man habe sich, so Hans-Georg Kremer heute, »durchaus nicht etwa als Opposition verstanden, sondern als DDR-integriert«. Die Teilnehmerzahlen stiegen von 900 im Jahr 1975 auf über 9500 im Jahr 1989. Dieser normativen Kraft des Faktischen konnte sich auch die DTSB-Führung nicht auf Dauer entziehen. Anders als etwa bei der eher marginalen Surferszene oder dem kleinen Kreis der Karatefans spürten die Rennsteigläufer in den 80er Jahre kaum noch Druck und Misstrauen. Allerdings gab es auch keine zentrale Finanzhilfe. Doch gerade das deshalb notwenige jahrelange Innovations- und Finanzierungstraining sollte sich nach 1990 als rettendes Know-how erweisen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.