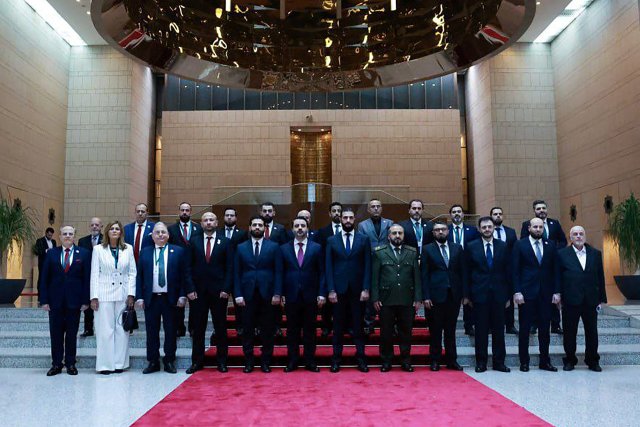- Politik
- Ostukraine
Drüben, das sind Leute wie wir
In den prorussischen Gebieten im Osten der Ukraine sind die Zerstörungen augenfällig, auch bei den Menschen
Der Weg nach Spartak führt von Donezk quer über die mehrspurige Yasynuvatskoye Schossej. Die mehrspurige Straße verbindet Donezk und Kashtanove, liegt aber zu nahe an der Front in der Ostukraine und ist deshalb gesperrt. Am Dorfeingang von Spartak steht eine schwarz-blau-rot gestrichene Stele mit stilisierter Ähre sowie Hammer und Sichel. Das Dorf liegt östlich des zerstörten Flughafens von Donezk. Es wird von den prorussischen Separatisten kontrolliert. Anders als viele Dörfer auf ukrainischer Seite ist Spartak nicht abgeriegelt. Der Vorort ist per Straße von Donezk aus erreichbar.
Im Krieg in der Ostukraine sind bis heute rund 13 000 Soldaten, Kämpfer und Zivilisten ums Leben gekommen, rund 1,5 Millionen Menschen sind geflüchtet, viele an andere Orte in der Ukraine. Noch immer kommt es täglich zu Verstößen gegen den Waffenstillstand. Vor einigen Wochen gab es einen besonders heftigen Vorfall: Damals hatten nach Angaben des ukrainischen Militärs die Separatisten bei Zolote das Feuer eröffnet und versucht, die »Trennlinie« zu überschreiten. Artillerie wurde eingesetzt, Tote und Verletzte waren die Folge.
Die Siedlungen um Spartak und das ukrainisch kontrollierte Nachbardorf Opytne sind gerade einmal anderthalb Kilometer voneinander entfernt. Doch die Frontlinie mit ihren Schützengräben sorgt dafür, dass in der Realität Welten zwischen den beiden Orten liegen.
Einst lebten in Spartak rund 2000 Menschen. Bis 2004, also lange vor dem Krieg, gab es sogar eine Straßenbahnverbindung in die Kleinstadt Awdijwka, die jetzt auch auf der anderen Seite der Frontlinie liegt. Landwirtschaft wurde betrieben, es gab eine Fabrik, die Tomatenpaste herstellte, eine andere für Fleischkonserven. Und der nahe gelegene Flughafen bot Arbeitsplätze.
In Spartak sind derzeit noch etwas über 30 Haushalte dauerhaft ansässig. Etwa 100 Leute, die weggezogen sind, beispielsweise nach Donezk, kehren von Zeit zu Zeit zurück, um nach dem Rechten zu schauen. Spartak ist unmittelbarer Vorort der Großstadt Donezk, die gern als Separatistenhochburg bezeichnet wird. In ihrem Zentrum, wo mittlerweile wieder rund zwei Drittel der Vorkriegsbevölkerung von rund 950 000 Einwohnern leben, pulsiert das Leben schon wieder. Aber die nördlichen und östlichen Außenbezirke und Vororte wie Spartak sind schwer gezeichnet und fast menschenleer.
Vor allem in den Außenquartieren des 1922 gegründeten Dorfes hat der Krieg gewütet, im Zentrum sieht es ein wenig besser aus. Als im Frühsommer 2014 die Kampfhandlungen begannen, brach schon bald die Versorgung mit fließendem Wasser, Gas und Elektrizität zusammen. Die Menschen, die zurückblieben, lebten zum Teil wochenlang in Schutzkellern. Erst seit dem vergangenen Jahr gibt es wieder Strom in Spartak.
»Schwierig auf beiden Seiten«
Valentina, Alexander, Jelena, Svetlana und Elena sitzen in einer beheizten Baracke, die eher einem Holzverschlag ähnelt, im Zentrum Spartaks. Neben ihrer spärlichen Pension verdienen sie sich ein paar russische Rubel in Spartak. Ihre Pension müssen sie in der benachbarten Kleinstadt Yasynuvata abholen. In dem Behelfsraum, wo sie sich gelegentlich treffen, werden normalerweise Hilfslieferungen oder einmal pro Woche auch Brot verteilt. Jetzt wärmen sie sich hier auf. Die Leute von Spartak warten auf das Ende des Krieges. Eine Zukunft sehen sie nicht mehr in der Ukraine, auch nicht in einem unabhängigen Donbass, sondern im Anschluss an die Russische Föderation, erklären sie.
Die faktische Abtrennung der prorussisch kontrollierten Teile der Gebiete (Oblasts) Donezk und Luhansk und die seither aufgebauten Strukturen in den sogenannten Volksrepubliken haben die Menschen physisch und psychisch vom ukrainischen Staat isoliert. Je länger der Konflikt ungelöst bleibt, desto mehr festigen sich die Institutionen. Zudem sind die Menschen in den Separatistengebieten gleichgeschalteten Medien ausgesetzt. Es gibt Zeitungen und regionale TV-Stationen wie Novorossja TV oder den Pervji Respublikanskji.
Alexander und Svetlana sind im Nachbardorf Opytne aufgewachsen, 1977 beziehungsweise 1981 jeweils nach ihrer Heirat mit ihren Ehepartnern in Spartak zusammengezogen. »Als mein Bruder mir im Internet gezeigt hat, wie es in Opytne aussieht, musste ich weinen. Opytne gibt es praktisch gar nicht mehr«, erzählt Alexander. Vom Haus, wo einst die Eltern wohnten, stünden nur noch die Wände.
Opytne ist von den ukrainischen Bezirksbehörden de facto aufgegeben worden. Es ist isoliert, die Versorgungslage schwierig. Alexander und Svetlana haben noch immer Kontakt mit Leuten aus dem Dorf. Viele von ihnen lebten jetzt in Donezk, erzählen sie. Dass manchmal Beschuss aus dem Nachbardorf erfolgt, nehmen sie nicht persönlich. »Es sind nicht unsere Verwandten, die die Projektile abfeuern. Die Zivilisten dort sind die gleichen Leute wie wir. Es ist schwierig auf beiden Seiten, dort und hier.«
Das Leben in Spartak und der sogenannten Volksrepublik Donezk ist nicht einfach. International sind die politischen Konstruktionen nicht anerkannt, von der Außenwelt nur schwer zu erreichen. Nachts herrscht seit Jahren Ausgangssperre, die in diesem Jahr über die orthodoxen Weihnachtsfeiertage erstmals aufgehoben, aber danach wieder verhängt wurde.
Alltägliche Trennungsroutine
Wirtschaftlich ist man fast komplett abhängig von Russland, der russische Rubel hat die ukrainische Griwna als Zahlungsmittel abgelöst. Die prorussischen Gebiete sind vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Eine Einreise über die Grenzübergänge von Russland wertet die Ukraine als Verletzung ihrer territorialen Integrität. Entlang der fast 500 Kilometer langen Frontlinie zwischen dem ukrainisch kontrollierten Territorium und den von den prorussischen Separatisten gehaltenen Teilen der Oblasts Donezk und Luhansk - »Volksrepublik Donezk« und »Volksrepublik Luhansk« - gibt es fünf Kontrollpunkte, die in ihrer Funktion Grenzübergängen ähneln.
Die Checkpoints Mariinka, Novotroitzke, Mayorsk und Hnutove können mit Fahrzeugen passiert werden, in Stanytza Luhanska ist dies nur zu Fuß möglich. Für den Übertritt wird neben Dokumenten zur Identifizierung zusätzlich ein Passierschein benötigt. Diese Bewilligung muss beim ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU beantragt werden. Es gibt eine genaue Liste, was mitgeführt werden darf und was nicht. Die Menschen dürfen nur Güter für den persönlichen Bedarf dabeihaben und auch Geldbeträge sind limitiert.
Der ukrainische Staatsgrenzdienst gab für Dezember des vergangenen Jahres eine Zahl von rund 1,17 Millionen Ein- und Ausreisen an den fünf Checkpoints an. Der Flüchtlingshilfsorganisation der Vereinten Nationen UNHCR zufolge überqueren die meisten Menschen die Übergänge, um Verwandte zu besuchen, ihre Pension abzuholen oder Geld bei der Bank abzuheben. Viele Pensionäre, die in Donezk oder Luhansk leben, beziehen dort und in der Ukraine eine Pension.
Waren in den ersten Jahren nach Beginn des Aufstands an den Übergängen teilweise Wartezeiten von einem Tag die Regel, hat sich die Situation im Laufe der Zeit etwas verbessert. Zusätzliche Grenzübergänge, über die auf dem Ukraine-Gipfel im Dezember 2019 diskutiert wurde, sind bis heute nicht realisiert worden. Aufgrund der Coronavirus-Epidemie wurden die Übergänge jedoch geschlossen.
Leben mit fünf Pässen
Pensionär Nikolai arbeitet vor einem Mehrfamilienwohngebäude in Spartak an einem Metallgitter. Er ist ethnischer Russe, geboren im Gebiet Kursk. Auf der ukrainischen Seite lebe noch eine Tante in Avdeevka, einer Kleinstadt, die gerade mal fünf Kilometer von Spartak entfernt liegt.
Nikolai kommt jeden Tag alleine nach Spartak, um nach dem Rechten zu schauen, damit nichts gestohlen wird. Nur wenn es abends zu spät ist, bleibt er hier. Im Keller, wo es einen Ofen gibt und wo er selbst gemachten Wein lagert. Seine Frau hat Angst, bleibt deshalb in Donezk. Nikolai hat fünf Pässe: Je einen ukrainischen Inlands- und Reisepass, je einen russischen Inlands- und Reisepass. Und den Pass der »Donezkaja Narodnaja Respublika«, der Volksrepublik Donezk. Die Russische Föderation hatte im letzten Jahr die Ausstellung von Pässen erleichtert, Tausende aus den Separatistengebieten beantragten daraufhin neue Papiere. Auch Nikolai sagt: »Das wäre die beste Lösung für mich. Wenn dies hier ein Teil Russlands wäre.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.