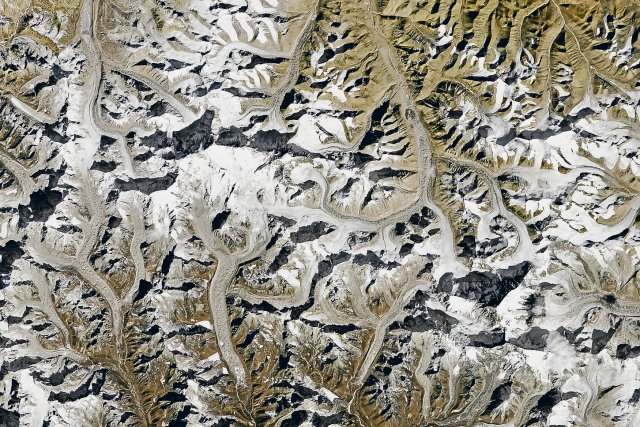- Wissen
- Drogenpolitik
O’zapft ist immer
Politik zwischen Zapfhahn und Prohibition
Heute werden beim Anblick der brachliegenden Theresienwiese in München wohl ein paar Tränchen verdrückt werden: kein Anstich, keine Händel, kein Riesenrad. Keine sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden sich in stickigen Bierzelten mit Maßkrügen zuprosten und dabei rund sieben Millionen Liter Bier runterkippen. Und alle verfügbaren Politiker*innen haben schon im Vorfeld in pathetischen Worten ihre Trauer über den Ausfall des größten Trinkgelages der Welt ausgedrückt.
Dabei geht es nicht nur um etwa eine Milliarde Euro, die heuer nicht in Bierzelten, Fahrgeschäften, Hotels, Taxis und so weiter liegen bleiben. Auch wenn sich das Oktoberfest selbstverständlich »unpolitisch« gibt, ist der größte Stammtisch der Welt normalerweise eine gute Gelegenheit, die Massen etwa für Wahlkämpfe zu mobilisieren. Da zeigt sich das politische Personal gern von der spaßigen Seite: Knödel, Geschunkel zu Liedern mit oft fragwürdigem Text, grinsendes Prosit in Richtung der Fans. Wer in Bayern, zumal in München, etwas werden will, kommt daran nicht vorbei. So verkündete vergangenes Jahr Kristina Frank, die für die CSU Oberbürgermeisterin werden wollte, sie sei täglich auf dem Bierfest zu finden. Man mag sich nicht vorstellen, was los gewesen wäre, wenn sie Ähnliches hinsichtlich eines täglichen Joints gesagt hätte.
Die Drogenkultur um den Alkohol ist in diesem Land schier unangreifbar. Vom »Boßeln« im protestantischen Friesland bis zum badischen »Frühschoppen«, bei dem man sich in Gegenwart des Priesters nach der Heiligen Messe betrinkt: Vieles von dem, was man »Brauchtum«, »Tradition« und »Geselligkeit« nennt, ist ein Setting fürs Trinken. O’zapft ist immer irgendwo - und selbst Bremerhaven hat ein Weinfest.
Gegen die Annahme, der Umgang mit dieser Droge sei durch ihre tiefe kulturelle Verankerung gut »eingeübt«, helfen nüchterne Fakten rund um die Wiesn: 2019 gab es kaum zehn Minuten nach dem Anstich die erste Alkoholvergiftung. 599 weitere sollten folgen - ein Erfolg gegenüber 720 Fällen im Jahr 2018. Kurz nach jener ersten Alkoholvergiftung musste vergangenes Jahr eine Bedienung behandelt werden, von einem Maßkrug im Gesicht getroffen. Schon zur Halbzeit verbuchte die Polizei 465 Straftaten - oft Körperverletzungen, aber auch 25 Sexualdelikte, darunter drei Vergewaltigungen.
Zwischen anderthalb und zwei Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholkrank, Dunkelziffern und Grauzonen dürften erheblich sein. Doch wer derlei im Umfeld von Wein- oder Bierfesten erwähnt, ist als »Spaßbremse« abgestempelt. Und wer gar Vergleiche zu anderen Drogenkulturen anstellte, die hierzulande weniger verwurzelt sind, hätte den Skandal in der »Bild« schon gebucht. Nicht nur die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verkündete vergangenes Jahr, wie nachvollziehbar und auch wichtig das Gemeinschaftserlebnis »Oktoberfest« sei.
Und es stimmt ja auch: Ein gemeinsames Bierchen schweißt zusammen, genau wie ein Kurzer auf die Gesundheit oder ein Joint in freundlicher Runde. Aber gilt nicht auch: Wer abwechselnd betrunken und verkatert ist, tritt nicht für seine Rechte ein? Auch die politische Linke hat sich immer wieder mit dem Alkohol befasst - ob es um Schnaps ging, der sich in der Industrialisierung zur Volksdroge aufschwang oder um das Bier, dessen Konsum im späteren 19. Jahrhundert in den Betrieben selbst gefördert wurde, um die Leute an den Maschinen vom Schnaps wieder abzubringen. Eine wirklich klare Position kam dabei aber nie heraus.
Historisch hatte zwar der linke Abolitionismus keine Chance, der um 1890 nur Abstinente in die wieder legalisierte SPD aufnehmen wollte. Damals obsiegte Karl Kautsky, der - ganz der Zentrist - den Alkoholismus verurteilte, nicht aber den Alkohol: Hatte sich die Partei in den Jahren ihres Verbots nicht gerade in Kneipen behauptet? Später sollte wiederum Antonio Gramsci in seinem berühmten Fragment zum amerikanischen »Fordismus« nicht etwa Alkohol, sondern im Gegenteil die Prohibition als Entstehungsbedingung jener Gesellschaftsform der Hochindustrialisierung nennen, die sich ganz nach der Logik der Fließbänder bildet.
Wie dem auch sei: Die Debatte um das Verhältnis von Rauschmitteln zu emanzipatorischer Politik hat den Sprung in die Spätmoderne geschafft. Die »umherschweifenden Haschrebellen« im Vor- und Umfeld der Revolte von 1968 sowie die abstinente Jugendkultur von »Straight Edge« fallen fast in die gleiche Dekade. Ob der klassischen »Autonomen« einst rigides, zuweilen körperlich durchgesetztes Alkohol- und Drogenverbot auf Demos noch gilt, mag mangels klassischer Autonomer kaum noch zu beurteilen sein. Doch abseits von politischen Aktionen finanziert der Alkohol bis heute auf »Solipartys« politische Projekte - und wird die Frage, ob auf politischen Plena getrunken werden darf, nie endgültig beantwortet werden.
Selbst in so gesundheitsbewussten Zeiten wie den heutigen ist jede Forderung nach einem Verbot des Alkohols ein politisches No Go. Ein Blick in die Zeit der amerikanischen Prohibition, die vor 100 Jahren in Kraft trat, reicht auch aus, um die in jeder Hinsicht verheerenden Konsequenzen solcher Versuche zu erkennen. Aus sozialmedizinischer Sicht war das Verbot ein Eigentor, weil statt des Bieres nun wieder stärkerer Stoff in Umlauf kam, sonst hätte sich der Schmuggel nicht gelohnt - etwa ein illegales Destillat namens »Moonshine« mit einem Alkoholgehalt von 70 Prozent. Und auf gesellschaftlicher Ebene wirkte die verordnete Entgiftung hochgradig toxisch, indem sie für einen historisch ungekannten Boom des organisierten Verbrechens sorgte. Diese Mafiastrukturen stiegen später auf Kokain und Heroin um - und korrumpierten oder zerstörten nebenbei über Jahrzehnte Teile der US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung.
Bis heute sind nicht nur die Drogen und die mit ihnen verbundene Kriminalität ein Problem, sondern auch der »Krieg« gegen sie. Sinnvoll ist daher eine Politik der Entkriminalisierung, was aber nicht mit Verharmlosung verwechselt werden darf. Das muss freilich auch für die legale Droge gelten, die so fest mit der europäischen Kultur verbunden ist. Doch stattdessen werden die Risiken des Alkoholkonsums bis heute routinemäßig verharmlost. »Präventionsarbeit« heißt oft genug, vor lediglich dem Trinkexzess zu warnen, während ein Zug an einem Joint schon zur Vorstufe der Drogenhölle erklärt wird: Noch 2019 bemüht zum Beispiel Andrea Tschacher, suchtpolitische Sprecherin der CDU in Schleswig-Holstein, die Phrase von Cannabis als »Einstiegsdroge«. Gewiss haben viele, die Opiaten oder Methamphetaminen verfallen, zuvor gekifft. Doch ebenso sicher haben sie sich am Anfang ihrer Suchtkarriere auch »ordentlich betrunken«.
Diese Doppelbödigkeit schadet der Glaubwürdigkeit der Drogenpolitik. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass eine Substanz wie Alkohol - die im Gegensatz zur Meinung der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig sehr wohl auch in geringen Mengen schädlich ist - vonseiten der Politik vehement verteidigt wird, wo mit anderen Substanzen nicht einmal richtig geforscht werden kann, selbst wenn es um eine Behebung der Schäden des Alkoholismus geht (siehe Interview).
Nun spricht sich die oben erwähnte Suchtexpertin Tschacher nicht nur gegen eine Legalisierung von Cannabis aus, sondern will auch »die Werbung für Alkohol« weiter »minimieren«. Dass aber erst ein Virus kommen muss, um auf der Münchner Theresienwiese, auf dem Cannstatter Wasen und anderswo die jährliche Gratiswerbung für die Trinkindustrie durch die versammelte Politprominenz pausieren zu lassen, zeigt, was vom zweiten Teil solcher Statements zu halten ist. Es ist ein kleines Glück, dass uns heuer verwackelte Selfies von Markus Söder mit einem Shrek-Maßkrug erspart bleiben und auch die kindischen Sticheleien entfallen, wie viele Schläge der Oberbürgermeister für den Anstich braucht. Vielleicht lässt sich diese Pause dazu nutzen, sich einmal ganz nüchtern auf das zu konzentrieren, was der Kern von Drogenpolitik sein sollte: nämlich die Mündigkeit der konsumierenden Menschen. Durch ein Verbot nicht des Alkohols, aber der Werbung für denselben würde diese gestärkt.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.