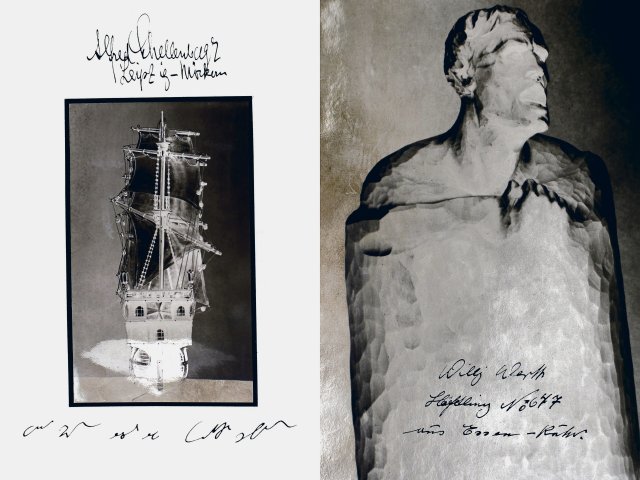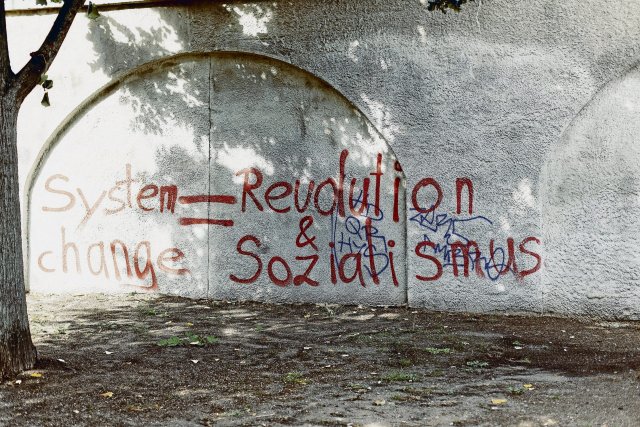- Kultur
- Helmut Lethen
Eine deutsche Liebesgeschichte
Helmut Lethen hat sich zeitlebens mit Rechten auseinandergesetzt - nun ist er mit einer verheiratet
Erst nach über 340 Seiten der Erinnerungen von Helmut Lethen kommt die Sprache auf das, was die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren mit besonderem Interesse verfolgt hat: seine Ehe mit Caroline Sommerfeld - inzwischen Sommerfeld-Lethen. Eine Art deutsche Romeo-und-Julia-Polit-Schnulze, auf der einen Seite der 68er und ehemaliges Mitglied der KPD/AO, der sich als Kulturwissenschaftler sein Leben lang mit der Anatomie des rechten Denkens beschäftigt hat, auf der anderen Seite die Frontfrau der Identitären Bewegung, die vor dem »Großen Austausch« warnt. Wie geht das zusammen?
Lethen nimmt sich ein Dutzend Seiten, um zu beschreiben, was mit seiner ehemaligen Studentin - die beiden lernten sich in seiner Zeit an der Universität Rostock kennen - und jetzigen Frau sowie Mutter dreier gemeinsamer Kinder nach 2015 passiert ist. Aus einem ökoliberalen Milieu stammend, wandelte sich Sommerfeld unter dem Einfluss von Literatur wie Jean Raspails »Das Heerlager der Heiligen« zur strammen Rechten. 2017 trat sie als Mitautorin von »Mit Linken leben« auf der Frankfurter Buchmesse mit Björn Höcke auf, sie schreibt regelmäßig für die Zeitschrift »Sezession« von Götz Kubitschek. Das hat Folgen. »Aufgrund der politischen Position von Caroline wurden unsere Söhne aus der Waldorfschule ausgeschlossen«, schreibt Lethen. Das ist eine zurückhaltende Umschreibung dessen, dass seine Frau durch völkische Propaganda - wobei sie sich auf den Schul- Guru Rudolf Steiner selbst berufen konnte - einen solchen Schritt provozierte, um sich dann als Opfer vermeintlich intoleranter Gutmenschen zu inszenieren. Ein mieses Spiel, das Lethen mit Verweis auf den Wert der Familie immerhin mitzuspielen bereit war.
Die Lebenserinnerungen von Lethen lassen sich jedoch keinesfalls auf diese Episode beschränken. Der ironisierende Titel »Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug« ist der »Dreigroschenoper« Bertolt Brechts entnommen - und war zugleich die Widmung, mit der Walter Benjamin das Exemplar von »Handorakel und Kunst der Weltklugheit« des Jesuiten Balthasar Gracián versah, das er Brecht schenkte. Warum das wichtig ist? Weil Lethens kanonisches Werk »Verhaltenslehren der Kälte« über die 20er Jahre als Zwischenkriegszeit das »Handorakel« zum Ausgang nimmt, als barocker Ratgeber in Zeiten der Gefahr und Intrige. Von Brecht geht ein lebenslanger Einfluss aus. Einen geradezu erschütternden Eindruck machte Alain Resnais’ Film »Nacht und Nebel« mit Kompositionen von Hanns Eisler auf den 1939 geborenen Lethen, der als Junge noch die nächtlichen Bombenangriffe auf die Städte Hitler-Deutschlands erlebte. Nach den »Verhaltenslehren der Kälte« veröffentlichte Lethen vor zwei Jahren eine Studie über »Die Staatsräte. Elite im Dritten Reich«.
Die akademische Karriere von Lethen nahm aufgrund seiner K-Gruppen-Mitgliedschaft einige Umwege. Er ging zunächst ins niederländische Utrecht, in den 90er Jahren hatte er eine Professur an der Universität Rostock inne, von 2007 bis 2016 war er der Leiter des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Intellektuelle Freundschaften verbanden ihn beispielsweise mit Heinz Dieter Kittsteiner, der zeitlebens eher an den Rändern des Geistesbetriebs wirkte. Lethen erzählt im munteren Plauderton alter, aber geistig reger Herren von bundesrepublikanischer Geistesgeschichte ebenso wie von der Kulturwissenschaft als Disziplin oder universitären Vortragsreisen in den USA. Das lässt sich auch als Porträt einer Generation von Geisteswissenschaftlern lesen, die noch nicht mittels inflationärer DFG- und Drittmittelanträge zu Science-Managern degradiert wurde, obwohl die Umbrüche der Institution, in der sich Lethen zeitlebens bewegte, doch erstaunlich unerwähnt bleiben.
»Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug« hat überhaupt einen eher schwelgerischen Unterton. Trotz des vorangestellten Adorno-Zitats aus der »Negativen Dialektik« taucht Gesellschaftsgeschichte kaum auf. So ist dann eben mit das Aufregendste an dem Buch schon das Dutzend Seiten über die Ehe mit dem politischen Gegner - und selbst die geben kaum etwas her.
Helmut Lethen: Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Erinnerungen. Rowohlt-Verlag, 384 S., geb., 24 €
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.