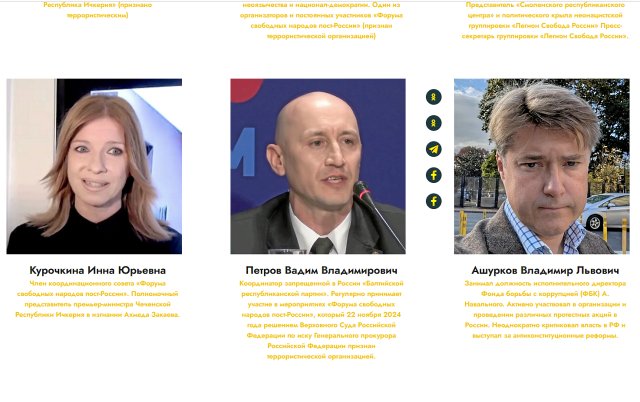- Politik
- Flutkatastrophe
Wie geht »richtig versichert«?
Der Ruf nach Versicherungsschutz für alle wird laut
Die vom Tiefdruckgebiet »Bernd« ausgelöste Flutkatastrophe hat nach vorläufigen Schätzungen Milliardenschäden verursacht. »Wir rechnen momentan mit versicherten Schäden in Höhe von 4 bis 5 Milliarden Euro«, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin. Die Betonung des früheren SPD-Politikers liegt dabei auf »versicherte« Schäden. Bundesweit sind 54 Prozent aller Wohngebäude nicht gegen Starkregen und Hochwasser finanziell abgesichert.
Dafür gibt es verschiedene Gründe. In der üblichen Wohngebäudeversicherung ist - anders als es in der DDR üblich war - keine Elementarschadenversicherung enthalten. Diese zahlte vor allem bei Schäden durch Überschwemmungen infolge von Hochwasser und Starkregen. Ein solcher Vertrag ist allerdings oft schwer zu bekommen. Das hängt mit den sogenannten Starkregengefährdungsklassen zusammen, die zwischen den Extremen »geringere Gefährdung« und »hohe Gefährdung« unterscheiden. Nach Verbandsangaben gelten 12 Prozent aller Adressen als hochriskant. In diesen Gebieten, berichten Verbraucherschützer, verweigern Unternehmen häufig einen Versicherungsschutz oder er wäre exorbitant teuer.
Was nicht allein an der »Natur« liegt, die ja längst nicht mehr natürlich ist. Im Schnitt wird jedes Unwetter immer kostspieliger. Dies liege, so der Rückversicherer Munich Re, an der zunehmenden »Konzentration von Bevölkerung und Werten«, etwa in der Infrastruktur. Außerdem gibt es den riskanten Trend, Neubaugebiete »am Wasser« zu bauen.
Linke und SPD, Verbraucherschützer und Ökonomen plädieren nun für die Einführung einer Elementarschadenversicherung für alle. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebt fast jeder Zweite in eigenen vier Wänden. Auch Mitglieder einer Wohnungsgenossenschaft und mittelbar Mieter dürften davon profitieren.
Assekuranzkonzerne wie der Branchenführer Allianz können der Idee wenig abgewinnen. Auch der Lobbyverband GDV ist skeptisch, weil eine »Pflichtversicherung« den Anreiz nehme, sich gegen Flut- und andere Extremwetterrisiken mit Barrieren oder Flutklappen zu wappnen. Durch die Blume lässt GDV-Geschäftsführer Asmussen uns wissen, dass ein Versicherungsschutz für alle doch akzeptabel wäre, wenn er über die private Versicherungsbranche organisiert würde. Vorbild könnte hierfür Großbritannien sein. Wer dort als Häuslebauer einen Hypothekenkredit aufnimmt, muss im Regelfall eine private Elementarschadenversicherung abschließen.
In Frankreich, Belgien oder Holland spielt der Staat eine größere Rolle. Hier springen im Notfall staatliche Fonds oder eine öffentliche Rückversicherung ein. Kritiker fragen allerdings, wieso die Allgemeinheit für Risiken aufkommen soll, die mehr oder weniger wohlhabende Eigenheimbesitzer betreffen. Allzumal, wenn Immobilien in Hochrisikogebieten liegen oder ein Finanzinvestment sind.
Der Teufel steckt also mal wieder im Detail. Praktikabel scheint ein Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu sein. Der Bundestag soll eine gesetzliche Pflicht zur Versicherung von Wohngebäuden gegen alle Naturgefahren beschließen. Im Trend würden Policen dadurch zudem billiger. Wenn die Prämien in bestimmten Lagen Hunderte Euro im Monat für ein Einfamilienhaus betragen, könnte der Staat die Last im Bedarfsfall durch einen zielgerichteten Transfer - entsprechend zum Wohngeld - mildern. Damit würde der Staat seiner Fürsorgepflicht gerecht, und die Versicherer freuen sich über Millionen neue Kunden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.