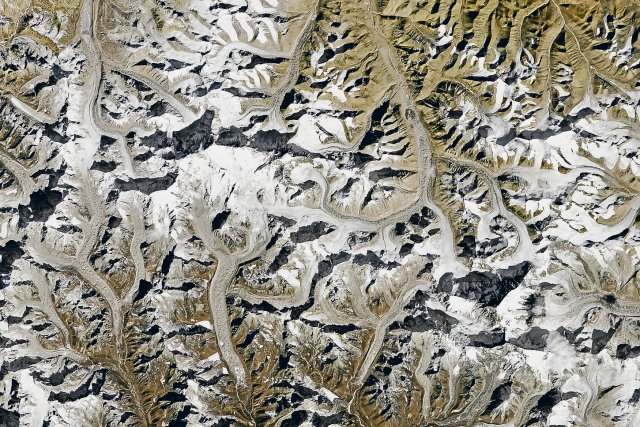- Wissen
- Geschlechterrollen
Zu weiche Männer
Wie der Ukraine-Krieg traditionelle Geschlechterrollen aktiviert

»Pesto schützt nicht vor Pistolen«, unter dieser Schlagzeile fordert Tobias Haberl im »Spiegel« mehr »Männlichkeit in Zeiten des Krieges«. Der Text steht symptomatisch für das bürgerliche Feuilleton, das die mangelnde »Wehrhaftigkeit« des deutschen Mannes kritisiert. Er sei verweichlicht, beschäftige sich mit Kochrezepten und väterlichen Gefühlen, statt die Rolle des Beschützers von »Frauen und Kindern« anzunehmen. Durch Drill geprägtes Mannsein hatte in Deutschland nach dem verlorenem Weltkrieg ein extrem schlechtes Image. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, angesichts der NS-Erfahrungen in der Bundesrepublik gesetzlich verankert, nahmen die Söhne und Enkel der Wehrmachtsangehörigen massenhaft in Anspruch. Als die bizarre Gewissensprüfung (»Was würden Sie machen, wenn ein Russe ihre Freundin im Park überfällt?«) abgeschafft wurde, entschieden sich ganze Gymnasialklassen für den Zivildienst. Sie verweigerten »per Postkarte«, waren danach in pflegerischen oder erzieherischen Berufen tätig. Das weitete ihr Rollenspektrum: vom harten Kämpfer zum fürsorglichen Mann.
Jetzt aber kehren soldatische Leitbilder zurück. CDU-Chef Friedrich Merz fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die vor gut zehn Jahren keineswegs abgeschafft, sondern nur ausgesetzt wurde. Im »Verteidigungsfall« kann der Staat nach wie vor über junge Männer behördlich verfügen, sie in Kasernen »einziehen« und auf die Schlachtfelder schicken. Der Militärdienst, in Westdeutschland mit der Gründung der Bundeswehr trotz Widerständen erneut etabliert, war stets ein Akt der Diskriminierung. Doch der männliche Zwang zu »dienen« wurde unausgesprochen als Ausgleich im Geschlechterverhältnis betrachtet, mit der Last des weiblichen Gebärens moralisch verrechnet. Protest kam vom links-christlichen Pazifismus, später auch von rechtspopulistischen Männerrechtlern.
AfD-Rechtsaußen Björn Höcke prangert seit Jahren die fehlende »Maskulinität« deutscher Männer an. Seine nun von bürgerlichen Leitartiklern aufgegriffenen Appelle, »mannhafter« zu agieren, haben historische Parallelen. In der Weimarer Republik störten sich Reaktionäre an der freizügigen Atmosphäre des Berliner Nachtlebens, der dort sichtbare Hedonismus untergrabe traditionelle Männlichkeit und schwäche die Volksgemeinschaft. Jetzt kehren solche Werte in die gesellschaftliche Mitte zurück. »Spiegel«-Autor Haberl wiederholt das Narrativ rechter Kommentare zur Kölner Silvesternacht, in der Frauen von migrantischen Männern belästigt wurden: »Wo waren eigentlich die Freunde dieser Frauen? Am Ende fanden einige Schutz hinter dem Türsteher eines Hotels, einem im heutigen Kroatien geborenen Mann.« Alphatypen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder Boxchampions wie Wladimir Klitschko, inzwischen Bürgermeister von Kiew, als neue männliche Rollenmodelle?
Das starke Geschlecht soll wieder seinen Mann stehen. Ist die vieldiskutierte »Krise der Kerle« damit vorbei? Als die »Zeit«-Autorin Nina Pauer in den 2000er Jahren über »Jammerlappen« und »Schmerzensmänner« herzog, war das im Kern eine Neuauflage der Softie-Schelte aus der Zeit der alternativen Bewegungen. »Die Brust des Mannes soll stark sein, aber wenn er mit stolz geschwellter Brust flaniert, wird er ruckzuck als Macho beschimpft«, schrieb damals Jonathan Widder in einer Replik auf Pauer: »Sensibel soll er sein, aber sobald er seine Gefühle zeigt, wird er als weinerlich verspottet. Er darf bitte nicht sein unverwundbares Selbstbewusstsein verlieren und seine wilde, männliche Stärke.« Körperkraft, Risikobereitschaft oder Mut sind keine schlechten Eigenschaften. Sie können auch im zivilen Leben nützlich sein. Aber sie repräsentieren nicht die Vielfalt von Männlichkeiten, die von der Genderforschung bewusst im Plural diskutiert wird. Das modische Bashing des »Caretakers« ist vollkommen überflüssig.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.