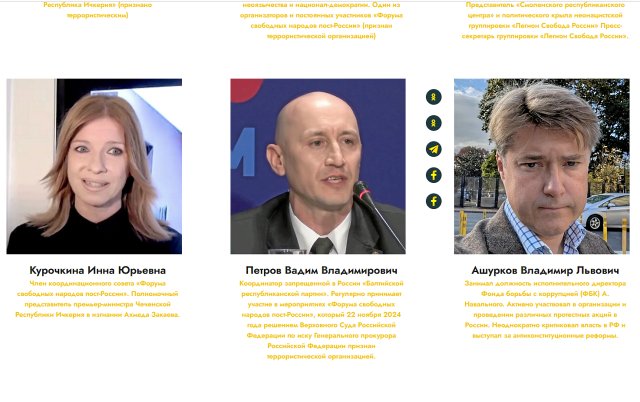- Politik
- Weltflüchtlingstag
»Ein Trauma ist oft durch Kontrollverlust gekennzeichnet«
Der Berliner Verein Xenion kümmmert sich um Geflüchtete, die psychosoziale Hilfe brauchen
Wer kommt zu Ihrem Verein Xenion?
Es kommen nach wie vor Menschen aus unterschiedlichsten Regionen: aus Afghanistan, aus Syrien, aus afrikanischen Ländern, aus der Russischen Föderation und neuerdings auch wieder aus der Türkei. Wir haben seit Ausbruch des Krieges auch sehr viele ukrainische Menschen, die zu uns kommen. Im Kinder- und Jugendbereich machen sie inzwischen mehr als die Hälfte der Neuanmeldungen aus. Fast alle, die zu uns kommen, haben Traumatisierungen erlebt – im Heimatland, aber oft auch zusätzlich auf der Flucht. Sie haben mit Verlusterfahrungen zu kämpfen und auch mit Belastungen hier im Aufnahmeland. Bei der Genese einer psychischen Traumafolgestörung ist das Sicherheitsgefühl ganz entscheidend. Viele Menschen erleben diese Sicherheit hier in Deutschland aber nicht sofort, sondern sind mit vielen Belastungen konfrontiert.
Janina Meyeringh ist Diplompsychologin und Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin. Sie arbeitet beim Berliner Verein Xenion, der psychosoziale Hilfe für politisch Verfolgte anbietet. Meyeringh leitet den Kinder- und Jugendbereich des Vereins. Mit ihr sprach Inga Dreyer.
Wie können Sie helfen?
Die Bedarfe sind sehr unterschiedlich. Nicht jeder Mensch, der schwere Traumata erlebt hat, braucht zum Beispiel eine Therapie. Um zu identifizieren, was Menschen brauchen, haben wir in Berlin ein gutes System: das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen. Dort werden Schutzbedarfe identifiziert und passende Angebote gesucht. Aufklärung und Information sind für uns ein wichtiger Ansatz. Traumatische Situationen sind oft durch Kontrollverlust gekennzeichnet. Deshalb ist es wichtig, Transparenz zu schaffen und zu erklären: Was passiert hier? Menschen müssen mitbestimmen, um wieder Kontrolle zu erlangen. Danach kommt die konkrete Unterstützung in alltagspraktischen Dingen wie dem Asylverfahren – und dann je nach Bedarf therapeutische Unterstützung.
Sehen Sie Unterschiede zwischen Menschen, die aus der Ukraine kommen, und denen, die seit vielen Jahren auf der Flucht sind?
Gerade bei den Kindern und Jugendlichen, die unbegleitet fliehen mussten, sieht man das deutlich. Bei ihnen macht es einen riesigen Unterschied, ob sie zum Beispiel schon seit zwei Jahren auf der Flucht sind. Sie mussten in dieser Zeit autonom werden, sich durchboxen und lernen, mit Belastungen umzugehen. Minderjährige, die alleine aus der Ukraine kommen, befinden sich teilweise noch in einer völligen Überforderung und wissen nicht, wie sie alleine zurechtkommen. Viele, die von weiter weg fliehen, haben auf dem Weg schwere Menschenrechtsverletzungen erlebt. Das führt zu schweren psychischen Folgestörungen. Die Symptome haben sich vielleicht schon chronifiziert, weil die Hilfen zu spät kommen.
Mit welchen Schwierigkeiten kommen Ukrainer*innen zu Ihnen?
Wir haben Jugendliche, bei denen entweder beide Elternteile oder zumindest der Vater zu Hause geblieben ist. Die Jugendlichen haben größte Ängste um ihre Familie, vor allem, wenn bestimmte Städte unter Beschuss stehen. Die Situation kann sich dann sehr schnell wieder entlasten, wenn die Familien den Ort gewechselt haben. In anderen Ländern, in denen seit Jahren eine dramatische Situation herrscht, haben viele Menschen im Laufe der Zeit Kontakte zu Angehörigen verloren. Bei den Ukrainer*innen ist das anders. Viele sind auch in Deutschland gut vernetzt.
Wie hat sich Ihre Arbeit mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs verändert?
Es gibt einen massiv erhöhten Bedarf an Beratung und Therapie. Das war auch schon in den letzten Jahren immer wieder so. Der Unterschied ist, dass unsere Appelle, dass wir mehr finanzielle Ressourcen brauchen, aktuell gehört werden. Das war letztes Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nicht der Fall.
Was müsste sich ändern?
Ein generelles Problem ist, dass uns Mittel für ein Jahr zur Verfügung gestellt werden und wir nicht wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wenn man sich anguckt, wie lange eine Therapie braucht, ist es absurd, dass wir Verträge befristen müssen, weil wir nicht wissen: Was ist ab Januar 2023? Deshalb lautet unser Appell an die Politik immer wieder, unsere Arbeit nachhaltig zu sichern. Wir sehen Menschen, die einen besonderen Schutz- und Therapiebedarf haben, aber müssen sie auf Wartelisten setzen oder können die Behandlung nicht fortsetzen. Das belastet uns und geht sehr an die Substanz. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Menschen eine kürzere Behandlungsdauer brauchen, wenn sie nahtlos Hilfe bekommen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.