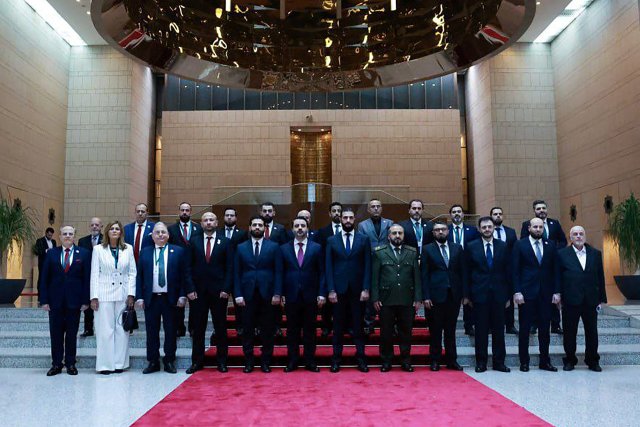- Politik
- Stadtentwicklung
Kleine Stadt ganz groß
Stade ist Provinz, manche leiden dort darunter. Aber jetzt sollen Surfer kommen

Am Horizont hebt ein Bagger seine Schaufel. Über einen der Erdwälle, die den Acker durchziehen, stapft Jan Podbielski. Bevor im nächsten Jahr die Bauarbeiten beginnen, wird das sechs Hektar große Gelände von Archäologen sondiert und auf gefährliche Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht. Die Erkundung findet im Auftrag des Rats der Stadt Stade statt. Podbielski lässt es sich nicht nehmen, als Geschäftsführer des 20 Millionen Euro umfassenden Projekts die Fortschritte selbst zu beaufsichtigen. Die Presse irritiert ihn dabei sichtlich. Fotografieren lassen will er sich nicht.
Hier soll der Surfgarten entstehen. In einem quadratischen Becken mit 160 Meter langen Kanten werden bis zu 90 Menschen gleichzeitig alle sieben Sekunden auf eine künstliche Welle treffen. »Wozu noch an den Atlantik fahren oder sogar nach Hawaii fliegen, wenn es knapp eine Fahrstunde von Hamburg entfernt die perfekte Welle gibt«, lautet das Motto. Stade soll zum Wellenreiter-Eldorado werden. Genauer: besagter Acker, zehn Kilometer von der Stadt entfernt, am Rande eines Naturschutzgebiets.
»Ich habe erst mal aufs Datum geschaut, ob es der 1. April ist, als ich 2018 davon gehört habe«, sagt Heiner Baumgarten. Der 71-jährige niedersächsische Ehrenvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wohnt in seinem Geburtsort Stade. Er hat zahlreiche Gründe, den Surfpark für einen schlechten Scherz zu halten. Während ständig von »Nachhaltigkeit« die Rede ist und in diesem Sommer allenthalben die Gefahren von Dürre beschworen wurden, haben Politik und Presse in Stade sich dafür starkgemacht, Wasser und Energie für elitären Surf-Spaß zu verschwenden.
Schon jetzt sinken nämlich die Grundwasserstände, und in den vergangenen Jahren kam es zu Engpässen bei der Trinkwasserversorgung. Die Beteuerungen, dass beim Surfpark lediglich Regenwasser eingesetzt werde, nennt der BUND »unrealistisch« und wirft Podbielski und den Befürwortern des Projekts mehrfach »ins Blaue hinein getroffene Aussagen« vor. Die Planung der Stadtverwaltung sei stellenweise »rechtswidrig«. So fehle die gesetzlich vorgeschriebene Umweltbilanz des Vorhabens, moniert er. Statt der veranschlagten 40 000 Kubikmeter Wasser jährlich schätzt der BUND den Verbrauch auf knapp 90 000.
Bis zu 200 000 Menschen jährlich sollen statt der etablierten Surf-Reviere auf der Elbe, an Nord- und Ostsee – vom Atlantik und Hawaii ganz zu schweigen – die Anlage auf dem flachen Land ansteuern. Diese Prognose scheint sehr optimistisch. Angewiesen sein werden die Surfurlauber auf die bereits für Dauerstaus berüchtigte Bundesstraße 73. Zu deren Entlastung wurde seit 1970 eine Autobahn nach Hamburg geplant. Das 2008 eröffnete Teilstück taugt dazu aber nicht und wird vor allem als Rennstrecke genutzt.
Die hätte der Autobauer BMW gebraucht, als Stade sich vor 20 Jahren, von vornherein chancenlos, für einen Werksstandort bewarb und das Gebiet erschloss, für das nun der Surfpark vorgesehen ist. Damals ging eine Epoche zu Ende, und ein Wort aus den 60er Jahren machte die Runde: »St. Ade«. 2003 wurde das Atomkraftwerk an der Elbe bei Bassenfleth abgeschaltet. Ab 1972 hatte es für einen Wohlstandsschub in der Kleinstadt gesorgt. In der Nachbarschaft siedelten sich der US-Chemiekonzern Dow und ein Aluminiumwerk an. Deren Gewerbesteuern finanzierten die Sanierung der Altstadt.
Die Gassen, die in den 90er Jahren sogar japanische Touristen anlockten, wirkten auf Peter Rühmkorf »wie aus einer Kunstkuchenform gebacken«. Der Schriftsteller machte 1951 in Stade sein Abitur. Bis zu seinem Tod 2008 ließ er sich in dem »allzu sehr herausgeputzten Städtchen« nur selten blicken. Eingeladen wurde er nie. Dass die Stadtbibliothek an seine Beziehung zu Stade erinnerte, als der linke Lyriker 1993 den Büchner-Preis erhielt, kam bei den Honoratioren nicht gut an.
Um die neuen Schilder für die Ortseingänge gab es 2005 einen skurrilen Streit. Sie sollten den Namenszusatz »Hansestadt« beinhalten, aber das niedersächsische Innenministerium verweigerte den Zusatz. Tatsächlich war Stade 1601 aus dem Handelsverbund ausgeschlossen worden. Für die Stadtentwicklung spielte er auch keine Rolle, wurde von den Lokalhistorikern übergangen und auch sonst nicht erinnert – bis man die Hanse als touristisches Lockmittel entdeckte. Dem wiederholten Drängen gab das Ministerium in Hannover schließlich nach. Seit 2009 darf sich Stade Hansestadt nennen.
»In Stade wird das Mittelalter lebendig« betitelte die Mainzer »Allgemeine Zeitung« in einem Reisebericht. Das täuscht. Nachdem 1659 ein Brand zwei Drittel der Häuser vernichtet hatte, erfolgte der Wiederaufbau zwar entlang des aus dem Mittelalter überkommenen Zuschnitts der Gassen, aber die Gebäude waren Barock und Rokoko. Ein prägendes Gebäude, der Schwedenspeicher, entstand erst 1705, als Mittelalter und Hansezeit längst vorbei waren. Überhaupt betrifft das märchenhafte, historische Flair eben nur die Innenstadt. Der weitaus größte Teil der rund 48 000 Einwohner lebt in Siedlungen.
Was mittelalterlich geblieben ist, kriegen Reisende nicht zu sehen. Die im 15. Jahrhundert gegründeten Brüderschaften sind Männergesellschaften, denen angehören muss, wer in der Stadt mitreden will. Alljährlich treffen sie sich in Frack und Zylinder zum Bankett und beschießen sich mit Papierkugeln. Ertappte Werfer zahlen ein Strafgeld, das an Arme verteilt wird. Früher wurden Reste vom Festmahl geschleudert, aber das ließen die Herren mittlerweile bleiben, erklärt einer von ihnen, denn »mit den Knochen hat man sich doch zu sehr die gute Kleidung bekleckert«. Der ehemalige Bürgermeister Andreas Rieckhof sprach von »den maßgeblichen 300«, die über die Geschicke der Stadt bestimmen.
Vom Surfpark verspricht sich das Rathaus »überregionale Strahlkraft«. Warum die zum Surfen Angereisten aber zwingend auch die Altstadt ansteuern sollten, bleibt wohl das Geheimnis derer, die sich das erhoffen. Alle Einwände gegen das Projekt wurden übergangen oder abgebügelt. »Die Politik hat sich nicht bemüht, Öffentlichkeit herzustellen«, fasst Heiko Malinski von der Bürgerinitiative gegen den Surfpark zusammen. »Das ist in Stade schon immer so gewesen«, bilanziert Heiner Baumgarten das Verfahren: Im Hinterzimmer Ausgehecktes wird auf Biegen und Brechen durchgepeitscht. Die Lokalzeitung »Stader Tageblatt« begründete ausführlich, warum sie kritische Leserbriefe nicht veröffentlichte, klärte aber nicht darüber auf, mit welchen Kosten der Surfpark den Stadthaushalt belastet. Die Grünen zerstritten sich über das ökologisch verantwortungslose Vorhaben. Im Rat votierten im Juli schließlich außer einer Minderheit ihrer Fraktion nur die beiden Linken und eine Piratin dagegen.
Lange bevor die Gas-Importe aus Russland zum Problem wurden und Brunsbüttel und Wilhelmshaven als Standorte für die Anlandung von Liquefied Natural Gas (LNG) ins Gespräch kamen, plante Stade einen Umschlagplatz. Die Entscheidungen darüber fielen so intransparent wie beim Surfpark. Inzwischen haben die Bauarbeiten begonnen, und ab dem Winter 2023 soll vor allem Fracking-Gas angeliefert werden.
Im Rathaus gibt es zwar eine »Bürgerfragestunde«, die für Transparenz und Austausch sorgen soll. Aber auf nerviges Nachhaken wird bisweilen einfach nicht geantwortet. Einer Bürgerin wurde im Juni sogar das Fragerecht entzogen, weil sie zu viele Fragen stellte. Die Parteien schwiegen dazu, und die Lokalzeitung begnügte sich damit, den CDU-Bürgermeister Sönke Hartlef zu zitieren: »Der Arbeitsaufwand ist nicht mehr hinnehmbar«. So wird der Politikverdruss geschürt. Bei Kommunalwahlen geht längst nur die Hälfte der Wahlberechtigten zur Urne, und eine echte Auswahl haben sie nicht. CDU, SPD und Grüne regieren in einer unerklärten großen Koalition.
Stade hat auch ein »Ghetto«, wie die Bewohner es selbst bezeichnen, eine Hochhaussiedlung aus den späten 60er Jahren, die zur Beute von betrügerischen Immobilienverwaltungen wurde. Der Großteil der 2500 Bewohner bezieht Hartz IV und hat Migrationshintergrund. Über ein Jahrzehnt wurden Millionen Fördergelder von Bund und Land investiert, unter anderem für mehrere Müll-Konzepte, die aber allesamt scheiterten. Die genaue Verwendung des Geldes blieb geheim.
Als typisch für Stade gilt der »Freiwillige Ordnungs- und Streifendienst«. Das 2007 vom Innenministerium in Hannover gestartete Projekt fand in Stade dauerhafte Resonanz. Für sieben Euro die Stunde spazieren Rentner-Paare durch die Gassen und maßregeln andere nach Gutdünken für mögliche Fehlverhalten.
Auch wenn sich die Stadt gegenüber Fremden geschichtsbewusst präsentiert, so gibt es doch erhebliche Erinnerungslücken. »Stades Vergangenheit birgt unschöne Kapitel« schrieb die Lokalzeitung im Mai über den Umgang mit der NS-Geschichte. Nach 1945 war die Stader Spruchkammer eine beliebte Adresse, um sich im Entnazifizierungsverfahren »Persilscheine« zu verschaffen. Die förmliche Aufarbeitung der NS-Zeit fand in Stade sehr viel später als in vergleichbaren Kommunen statt, und der damit beauftragte Historiker durfte nicht alles aufschreiben, was er wusste, zumal wenn es um »die maßgeblichen 300« ging.
Einem von ihnen, Gustav Wolters, wurde 2002 zur Aufgabe seines Feinkostladens vom Bürgermeister ein Ehrenbrief des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) überreicht. Das Kanzleramt wusste offenbar nichts über die hinlänglich bekannten Verbrechen des früheren SS-Mannes in einem Einsatzkommando bei der Gestapo. Leserbriefe dazu wies die Lokalzeitung als »üble Nachrede« zurück und veröffentlichte selbst Artikel, in denen die Kritiker der Ehrung diffamiert wurden.
Die Geschichte mit der Pferdewurst habe er zunächst gar nicht glauben wollen, erklärte Stefan Aust. »Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, dass sie spinnen würden. Solche Beknacktheiten kann man sich gar nicht vorstellen.« Aust, 1946 in Stade geboren und aufgewachsen, meinte die Schilder, die 1997 an den Türen von Gastwirtschaften hingen – um Sinti und Roma abzuschrecken, denen das Pferd heilig ist. Der »Spiegel«, den Aust damals leitete, griff das Thema auf und verschaffte seiner Heimatstadt, in der er »wenig verwurzelt« ist, »überregionale Strahlkraft«.
Dafür wäre ein anderer Autor geeignet, dessen Geburtshaus seit 1996 eine zunächst unerwünschte Gedenktafel ziert. Fremdenführer machen dort nie Halt. Sie müssten davon erzählen, dass Ernst Harthern (1884-1969) bereits 1924 vor dem anschwellenden Antisemitismus floh. Und sie müssten von seinem Bestseller reden, der als Ursprung aller autobiografischen Berichte von trans Personen gilt: »Lili Elbe. Ein Mensch wechselt sein Geschlecht«, die Aufzeichnungen eines dänischen Malers, die Harthern unter dem Pseudonym Niels Hoyer bearbeitete und 1932 herausgab.
Judentum und Transsexualität passen nicht zum Mittelmaß von Stade. Eher schon eine Geschichte aus dem »Tageblatt« vom Mai: »Staderin entwirft App zum Planen der eigenen Beerdigung«. Sie habe dazu »viel recherchiert«, erklärt die Erfinderin, »vor allem bei Leuten mit Nahtod-Erfahrungen«. Ein Spaziergang durch Stade am späten Nachmittag außerhalb der Touristensaison, wenn die Bürgersteige hochgeklappt werden, kommt einer solchen Erfahrung
erstaunlich nahe.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.