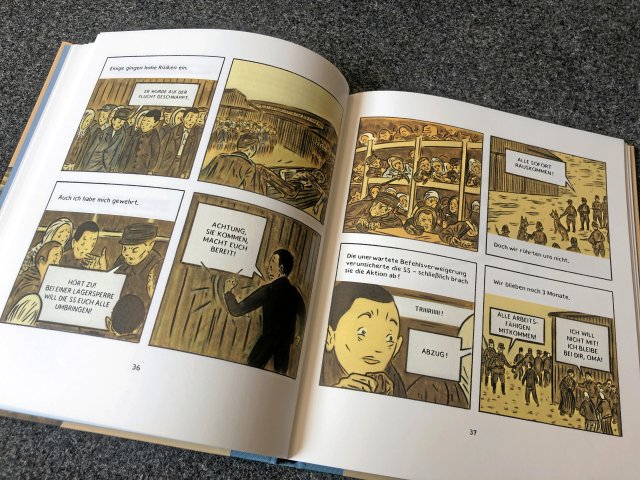- Berlin
- Rassistische Razzien
Sie kommen immer wieder
Betreiber von Shisha-Lokalen in Neukölln berichten von der starken Belastung durch Razzien
Die Sonnenallee in Neukölln ist gut belebt am frühen Montagabend. Passant*innen gehen einkaufen, essen oder warten an den Bushaltestellen auf den M41. In den Cafés und Bars sitzen viele Gäste plaudernd an den Tischen, trinken Kaffee oder Tee und rauchen Wasserpfeife. Während die Stimmung allgemein entspannt ist, reagieren Betreiber*innen, Beschäftigte und Gäste deutlich angespannt auf Journalist*innen – kaum verwunderlich, wird doch gerade die Sonnenallee in der medialen Öffentlichkeit oft als Schauplatz von Verbrechen und Parallelgesellschaften dargestellt. Ein Grund dafür ist die pauschalisierende Politik der Berliner Polizei, groß angelegte Razzien regelmäßig in Shisha-Cafés und -Bars durchzuführen und öffentlichkeitswirksam als Maßnahme gegen organisierte Kriminalität zu inszenieren.
»Es ist wirklich schlimm. Die kommen ständig hier rein, aber finden nichts«, so ein Inhaber eines Shisha-Lokals auf der Sonnenallee in der Nähe der Pannierstraße zu »nd«. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen, von bisheriger Berichterstattung über die Situation zeigt er sich hochgradig genervt. Die Frustration ist ihm deutlich anzumerken, wenn er über die starke Belastung durch die Razzien spricht.
»Wir sind kein Clan, das wissen die doch genau. Warum kommen sie dann immer wieder?«, so der Inhaber. Mit kriminellen Strukturen habe er nichts am Hut, alle Beschäftigten seien ordentlich angestellt, das einzige Problem seien die ständigen Polizeimaßnahmen in seinem Lokal aufgrund »irgendwelcher Vermutungen«, sagt er. Er berichtet, dass sein Bruder wegen der Situation bereits aufgehört habe, den Laden mit ihm zusammen zu betreiben. »Jetzt muss ich das alles alleine hier machen«, sagt er.
Im Bezirk Neukölln kochte die Debatte um Razzien vor einigen Wochen wieder hoch, als Linke-Bezirksstadträtin Sarah Nagel das ihr unterstellte Ordnungsamt anwies, sich an einem Verbundeinsatz zur Kontrolle eines Restaurants nicht zu beteiligen. Die meisten der groß angelegten polizeilichen Gewerbekontrollen zur Kiriminalitätsbekämpfung werden im Verbund mit anderen Behörden wie zum Ordnungsamt durchgeführt. Nagel kritisierte diese Einsätze bereits in der Vergangenheit – zum Missfallen anderer Bezirkspolitiker*innen, die nun beantragt haben, der Linkspolitikerin die Kontrolle über das Ordnungsamt zu entziehen. Der Antrag wird in der kommenden Bezirksverordnetenversammlung diskutiert. Derweil kritisieren antirassistische Initiativen schon lange die Razzienpraxis in Neukölln, weil sie migrantische und migrantisierte Menschen und Einrichtungen unter Generalverdacht stellten, sich an kriminellen Strukturen zu beteiligen.
Garip Ateş betreibt das Shisha-Café »Vadi« in der Hermannstraße in Neukölln. Im vergangenen Jahr habe er drei Razzien in seinem Lokal durchmachen müssen, sagt er dem »nd«. »Mit 30 bis 40 Leuten kommen sie hier rein, als wären wir gefährlich«, so beschreibt er die Situationen. Ihn stört die unverhältnismäßige Aggressivität der Einsätze, wenn eine so große Gruppe an Polizist*innen das Lokal und alle Kund*innen durchsuche, obwohl teilweise nur sechs bis sieben Gäste anwesend seien. Auch in seinem Lokal fänden sie, wenn überhaupt, nur Kleinigkeiten. »Es ist nie was Schlimmes gewesen. Hier sind keine Waffen zu finden und nichts, und trotzdem kommen sie immer wieder«, so Ateş. Seinetwegen könnten sie jeden Tag zur normalen Kontrolle mit drei oder vier Beamten vorbeikommen, sagt er. Aber die überzogenen Großeinsätze ließen ihn aussehen wie einen Verbrecher und verbreiteten Angst.
»Ich habe bestimmt 20 bis 30 Prozent meiner Gäste verloren«, so der Cafébetreiber. Die Razzien seien nicht alleine daran Schuld, auch die Pandemie spiele dabei eine Rolle. Aber es sei auch die ständige Befürchtung, dass alle Anwesenden während einer Razzia durchsucht werden, wenn sie sich in seinem Lokal aufhalten. Das sei für ihn selbst andauernder Stress, der sich auch auf seine Gesundheit auswirke, und außerdem eine finanzielle Belastung. »Ich will von dem Laden hier leben. Ich bekomme kein anderes Geld oder Hilfen«, sagt Ateş.
Schon seit den 90ern lebe er in Berlin und habe sich kaum etwas zuschulden kommen lassen. »Ich bin ein sauberer Mensch, habe nichts in der Akte. Warum kommen sie immer wieder zu mir?«, fragt er. Sein Café in der Hermannstraße betreibt Ateş bereits seit 2015, die Zahl der Razzien habe seitdem beständig zugenommen. »Es werden jedes Jahr mehr«, sagt er. Mit anderen Shisha-Cafés im Stadtteil stehe er in gutem Kontakt, denen gehe es genauso wie ihm, es gebe dieselben Probleme mit den Polizeikontrollen. »Ich habe wirklich die Schnauze voll«, sagt Ateş.
Politikwissenschaftler Mahmoud Jaraba kann den Frust gut nachvollziehen. Seit 2015 forscht er zusammen mit arabischen, türkischen und kurdischen Familien, die stark unter der Stigmatisierung durch Polizei und Öffentlichkeit leiden. Auch er kennt daher die Problematik mit den zunehmenden Razzien in Shisha-Lokalen in Neukölln. »Es ist hoch belastend. Es macht nicht nur Stress, es ist auch pauschalisierend und diskriminierend gegen Shisha-Bars und -Cafés«, sagt Jaraba zu »nd«. Zwar gebe es durchaus auch in diesem Umfeld kriminelle Strukturen, aber das treffe nur auf einen kleinen Teil zu. »Shisha-Cafés sind Teil der arabischen Kultur. Viele ganz normale Menschen gehen sehr gerne dorthin«, so Jaraba.
Das Problem der polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen sei, dass oft nicht im Vorfeld unterschieden werde, wer tatsächlich potenziell in kriminelle Geschäfte eingebunden sei und wer nicht. Stattdessen werde gegen alle Besucher*innen der Lokale hart vorgegangen. »Es muss gezielt ermittelt werden. Es kann nicht sein, dass sie überall mit 100 Polizist*innen reingehen. Teilweise sind sogar Politiker*innen und Presse dabei«, sagt Jaraba. So entstehe öffentlich ein stigmatisierendes Bild, während gleichzeitig das Vertrauen der Betroffenen in den deutschen Staat schwinde.
Jaraba hat für den Mediendienst Integration eine Expertise aus seinen bisherigen Forschungsergebnissen zusammengestellt. Er betrachtet die Arbeit der Polizei zur Bekämpfung der sogenannten Clankriminalität äußerst kritisch, denn diese unterstelle, dass es überhaupt eine gemeinsam organisierte Clanstruktur gebe, also dass Tausende Menschen, die sich auf einen gemeinsamen Vorfahren beziehen und denselben Familiennamen tragen, tatsächlich eng zusammenarbeiten. »Wenn überhaupt, dann passiert dies in Sub-Sub-Clans«, so Jaraba bei der Vorstellung seiner Expertise am Mittwochmorgen. Der Großteil der Familienmitglieder sei nicht kriminell, werde aber trotzdem diskriminiert, zum Beispiel bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Wohnung.
Dass die polizeiliche Strategie zur Kriminalitätsbekämpfung fragwürdig ist, zeigt sich auch in den von der Berliner Polizei seit 2019 selbst erstellten jährlichen »Lagebildern Clankriminalität«. Im Jahr 2021 habe man 572 Objekte kontrolliert, darunter 214 »Cafés/Bars« und 119 »Shisha-Bars«. Hauptergebnisse der Großdurchsuchungen: 2103 Verkehrsverstöße, 201 Verstöße gegen das Betäubungsmittel- beziehungsweise Arzneimittelgesetz, 199 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Polizei gibt selbst zu bedenken, dass es sich dabei um Kontrolldelikte handelt, die erhöhten Fallzahlen also auf die erhöhte Anzahl von Durchsuchungen zurückzuführen sind. Zur Einordnung: Man stelle sich einmal vor, im Lieblingsclub würden zweimal im Jahr sämtliche Anwesenden auf Drogen kontrolliert oder in der vierspurigen Straße nebenan alle Falschparkenden zur Rechenschaft gezogen.
Auf der Sonnenallee selbst betrachten viele Neuköllner das Vorgehen der Polizei skeptisch. So berichtet ein Verkäufer in einem Spätkauf davon, wie oft vor allem im nördlichen Teil der Straße polizeiliche Durchsuchungen durchgeführt würden, wo sich besonders viele Shisha-Lokale befinden. »Es ist nicht richtig, alle über einen Kamm zu scheren, anstatt gezielt vorzugehen«, sagt er. Oft würden Vorwürfe erfunden. Bei ihm selbst im Laden sei es glücklicherweise ruhig, so der Verkäufer, der selbst in Neukölln aufgewachsen ist. »Was sollen die ganzen Razzien bringen?, fragt ein weiterer Späti-Verkäufer in der Nähe des Hermannplatzes. Sie sperren ständig die ganze Straße, und alle haben Angst.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.