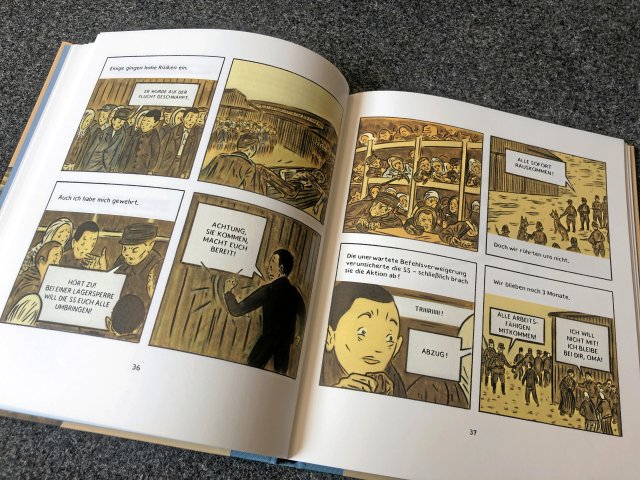- Berlin
- Umwelt
Wasserhaushalt nach Kohleausstieg: Gefahr für »Spree-Athen«
Fehlendes Grundwasser aus den Tagebauen der Lausitz wird der Spree künftig fehlen und bereitet Kopfzerbrechen in Berlin und Brandenburg
Immer wieder schmückt sich Berlin mit dem Beiwort »Spree-Athen«. Doch inzwischen muss der Mensch darum kämpfen, dass die Lebensader der deutschen Hauptstadt überhaupt noch erhalten bleibt. Nicht nur die tendenzielle Trockenheit, vor allem in der Lausitz, sondern auch der terminierte Ausstieg aus der Braunkohleverstromung haben die Aussichten für die Spree gravierend verändert. Bei der Frage, woher Berlin in Zukunft sein Wasser beziehen will, schießen die Pläne ins Kraut.
Weniger Regen, abgesenktes Grundwasser und künftig auch kein Grundwasser aus den Tagebauen der Lausitz mehr: Die Frage, woher die Spree künftig ihr Wasser beziehen soll, wird zudem dadurch verschärft, dass der Wasserabfluss aus der Umgebung der Spree in Zukunft eingeschränkt werden wird.
Kritik gibt es auch am Zustand der ländlichen Wasserschutzeinrichtungen und der sogenannten Meliorationsanlagen, mit dem Erdboden verbundene Be- und Entwässerungssysteme. Wie Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) kürzlich in Potsdam feststellte, hätten diese zu DDR-Zeiten angelegten Anlagen damals vor allem noch der Entwässerung gedient. Heute komme es darauf an, sie so instand zu setzen, dass sie – gerade nach Starkregen – mehr und länger Wasser zurückhalten könnten, so Vogel.

nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik - aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin - ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.
Im Konkreten geht es letztlich um Staumauern, Gräben und Wehre, die seinerzeit für die Landwirtschaft der DDR angelegt wurden. Vogel sprach in Potsdam von einer »intensiven Entwässerungslandwirtschaft«. Er bestätigte, dass die Instandsetzung dieser einst von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) betriebenen Anlagen eine wichtige Aufgabe der örtlichen Wasserverbände darstelle. Angesichts der Tatsache, dass man in den vergangenen Jahren ein deutliches Wasserdefizit aufgebaut habe, komme es nun darauf an, diese Anlagen so zu ertüchtigen, dass sie länger das Wasser in der sie umgebenden Landschaft halten könnten als bisher.
Vor Jahrzehnten war es hingegen vor allem darum gegangen, Wasser abzuleiten, damit die Äcker nicht verschlammen. Landwirtschaftliche Flächen, auf denen das Wasser »steht« und stehen bleibt, erfüllen ihren Zweck nicht. Für das praktische Handeln heute bedeutet das, den Ansprüchen der Nahrungsgüterproduktion wie auch des Naturschutzes gerecht zu werden. Zu viel Wasser kann in diesem Zusammenhang genauso ein Problem darstellen wie zu wenig Wasser.
Wasser zurückzuhalten bedeutet aber auch, dass es nicht in die umliegenden Flüsse eingeleitet wird. Auf genau diesen Effekt wies vor Kurzem etwa der Brandenburger Abgeordnete Wolfgang Roick in einer Landtagsdebatte hin. Der SPD-Politiker warnte vor erheblichen Auswirkungen auf den Wasserstand der Spree und demzufolge auch auf die Wasserzufuhr für Berlin. Wenn in absehbarer Zeit mit dem Braunkohleabbau auch das Einleiten von Grubenwasser in die Spree ausbleibe, werde der Fluss voraussichtlich einen Großteil seines Wassers verlieren, so Roick. Wenn dann auch noch Verluste dadurch entstünden, dass beidseits der Spree kein Wasser mehr eingeleitet werde, stelle das eine Verschärfung der ohnehin schon schwierigen Situation dar. Dem SPD-Abgeordneten zufolge müsse nun gelten, die Erwartungen und Bedarfe Brandenburgs wie auch die Berlins besser abzuwägen.
Zudem kritisiert der Abgeordnete Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) die Vernachlässigung der Meliorationsanlagen in der Landwirtschaft. Wenn der Ausstieg aus der Braunkohleförderung Realität werde, dann werde das Abpumpen des Grubenwassers nicht allein zugunsten der Spree stattfinden – es werde verboten sein, unterstrich er. »Wenn nicht die Fragestellung lauten sollte ›Wem nehmen wir das Wasser weg?‹, dann müssen wir über eine gerechte Verteilung nachdenken.« Aus seiner Sicht läuft das auf die Rationierung des Trinkwassers in Berlin ab Mitte der 30er Jahre hinaus. Denn 70 Prozent des heute in der Hauptstadt genutzten Wassers sei Oberflächen-Filtratwasser aus Spree und Havel. Entsalztes Wasser aus der Ostsee sei eine Möglichkeit, aber »wohl zu teuer«, merkte Zeschmann an.
Für den CDU-Abgeordneten Ingo Senftleben sind neue Speichersysteme die Lösung. Freilich keine, die der Spree Wasser verschaffen. Senftleben forderte dazu auf, darüber nachzudenken, wie Wasser aus anderen Regionen herangeführt werden könne. Im Raum steht die Idee, Schmelzwasser der Elbe in die Lausitz zu lenken und in den dortigen Tagebauseen gewissermaßen zwischenzulagern. Zeschmann (BVB) wies darauf hin, dass die Planungen und Bauarbeiten eines solchen Mammutprojektes 20 Jahre in Anspruch nehmen würden. Man müsse also schleunigst damit beginnen, wenn es zumindest mittelfristig Wirkung haben solle.
Umweltminister Vogel verwies auf die fehlende qualitative Voruntersuchung eines solchen Projekts. Er sprach sich dafür aus, die Ansprüche Berlins und Brandenburgs gemeinsam zu betrachten: Zweifellos sei Berlin angewiesen auf das Wasser, das aus Havel und Spree zufließe. Das System funktioniere nur, wenn mindestens acht Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Hauptstadt erreichten. Es gebe aber Zeiten, in denen der Wert unter vier Kubikmetern liege.
Linke-Abgeordnete Anke Schwarzenberg erkundigte sich nach den Aussichten, die Spree mit Wasser aus östlichen Regionen zu befüllen. Wer den Spree-Zufluss mit Wasser aus Oder und Neiße sichern wolle, der dürfe »die Rechnung nicht ohne den polnischen Wirt machen«, mahnte Vogel. Die polnische Regierung sei daran zu beteiligen. Angesichts der hohen Verdunstungsrate von Wasser im Spreewald sollte über eine Reduzierung des Gewässersystems nachgedacht werden. Auch in der Vergangenheit habe es schon Situationen gegeben, in denen der Kahnbetrieb des Spreewalds eingeschränkt gewesen sei.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.