- Wirtschaft und Umwelt
- Krankenhausreform
Stationäre Versorgung: Gute Absicht, schlechter Plan
Die Bundesregierung beschließt das wichtigste Gesetz der Krankenhausreform
Trotz Kritik und Widerstands aus den Bundesländern und der Klinikbranche hat das Bundeskabinett am Mittwoch das wichtigste Gesetz zur Krankenhausreform passieren lassen. Die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebte »Revolution« für den Sektor soll nicht nur die Behandlungsqualität verbessern, sondern das soll auch mit einer Konzentration der Angebote auf weniger Häuser verbunden sein. Soweit jetzt absehbar, würde sich die Zahl der Kliniken verringern, was den Bundesländern überhaupt nicht recht ist. Sie sind zwar für die Krankenhausplanung zuständig, aber sie müssten nun auch aktiver in die Umstrukturierung der stationären Versorgung eingreifen, die sie zuvor vielerorts entsprechend den Wünschen großer Trägergruppen laufen ließen. Jetzt könnte es um Zusammenlegung von Häusern oder auch um Schließungen gehen.
Insbesondere dass hierfür im Bund die Weichen gestellt werden, stört die Landesregierungen. Sie wollen mehr Ausnahmen durchsetzen. Gelingt ihnen das aber, wird der Reformansatz unterlaufen, gleichzeitig aber viel zusätzliches Geld verteilt. Das wiederum monieren die gesetzlichen Krankenkassen, weil sie – oder besser ihre Beitragszahler – ab 2026 für die Hälfte der geplanten 50 Milliarden Euro im geplanten Transformationsfonds, der Krankenhäuser bei Umstrukturierungen unterstützen soll, aufkommen sollen. Die andere Hälfte müssten die Bundesländer beitragen.
Mit der Reform soll sich die Vergütung ändern. Die sogenannten Fallpauschalen, bei denen die Kliniken je Behandlungsfall eine feste Summe abrechnen konnten, setzten falsche Mengenanreize und führten in manchen Bereichen, etwa beim Einsatz künstlicher Gelenke, zu einer Überversorgung. Andererseits sind die Krankenhäuser bestrebt, die Pauschale zu kassieren, aber gleichzeitig die eigenen Kosten zu senken: zu Lasten der Pflege wie auch der Patienten, die man möglichst schnell wieder entlassen will. Die Fallpauschalen bleiben laut Reform zwar, aber sie sollen ergänzt werden durch einen festen Sockel von 60 Prozent der Vergütung dafür, dass eine Grundausstattung mit Personal und Technik für bestimmte Leistungen vorgehalten wird, unabhängig von der Zahl der Fälle. Extra-Zuschläge soll es für Bereiche wie Kinderheilkunde, Geburtshilfe und Intensivmedizin geben.
Zur Verbesserung der Behandlungsqualität soll die Einführung von Leistungsgruppen beitragen. Für 65 dieser Gruppen, zum Beispiel Infektiologie oder allgemeine Kardiologie, wird es Vorgaben zu Personal und Technik geben. Nur wer diese Vorgaben erfüllt, kann in Zukunft die entsprechenden Leistungen abrechnen.
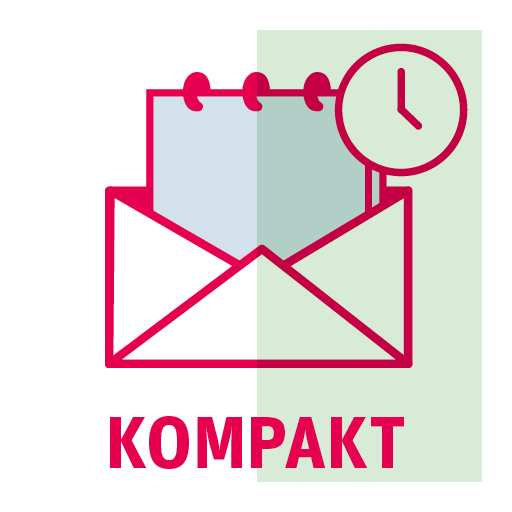
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Ein Problem: Die Leistungsgruppen erfassen nicht alles, was Krankenhäuser bisher anbieten. Ob die nicht aufgeführten Fachgebiete – wie das Querschnittsfach Schmerzmedizin – in Zukunft weiter Patienten versorgen können, hängt nach bisherigem Stand von Geschick und Interesse der Krankenhausleitungen und von deren Trägern ab. Als sicher kann hier nichts gelten. Ärzte der möglicherweise in Zukunft zurückgestellten Fächer, darunter die Diabetologie, fürchten eine Benachteiligung oder gar ihr Verschwinden und eine deutliche schlechtere, nicht koordinierte Versorgung von Patienten mit mehreren Erkrankungen.
Die Leistungsgruppen sollen aber in Zukunft die Basis dafür sein, dass Vorhaltekosten tatsächlich einen festen Anteil an der Klinikfinanzierung bilden können, in Ergänzung zu den Fallzahlen. Die Bundesländer sollen in ihrer Krankenhausplanung festlegen, wo welche Leistungsgruppen angeboten werden.
Die Bundesländer vermissen zugleich eine Auswirkungsanalyse der Reform. Dabei geht es nicht nur um die Versorgung außerhalb der Leistungsgruppen. Auch in diesen sei mit einer Verknappung der Angebote zu rechnen, weil nicht alle Kliniken die Anforderungen erfüllen werden. Wo die bisher versorgten Patienten mit den entsprechenden Diagnosen dann hingehen sollten, diese Frage treibt Landespolitiker und Opposition um. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert, dass die Rerfompläne »die Überversorgung in Ballungszentren und die sich immer mehr zuspitzende Unterversorgung auf dem Land« nicht beenden.
In den letzten Wochen gab es wiederholt die Kritik, dass die Reform sich eher an abstrakten und komplizierten Berechnungen orientiert als am tatsächlichen Bedarf. Wie kann dieser aber festgestellt werden? Wird die Bevölkerung im Schnitt zwar älter, bleibt aber im Verhältnis zu früheren Generationen gesünder? Oder werden viele ältere Menschen tatsächlich gebrechlicher und benötigen mehr medizinische Versorgung? Es gibt zwar einige große Kohortenstudien in Deutschland wie die Nako, bei der die Entwicklung etwa bei Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herzleiden mit über 200 000 Teilnehmenden langfristig erforscht werden. Zuverlässige und zeitnahe Vorhersagen zur Entwicklung der Patientenströme fehlen aber und sind auch deshalb schwierig, weil die Digitalisierung im Gesundheitswesen zurückhängt. In den Krankenhäusern sei aktuell jedes dritte Bett nicht belegt, so der Gesundheitsminister. Die geringe Auslastung, die in der Pandemie begann, hat sich scheinbar verstetigt. Als Ursachen werden einerseits fehlende Pflegekräfte vermutet, andererseits die Tendenz, bestimmte Eingriffe oder Diagnoseverfahren ambulant durchzuführen, etwa Leisten- und Gelenkoperationen. Auch hier fehlen Daten – doch die könnten für das Gelingen der jetzt angelegten Reform mitentscheidend sein.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







