- Kultur
- Kaffee als DrogeDas Beste aus dem nd
Wachwerden als Menschwerdung
Eine Droge, die schwer erhältlich ist: die gute Tasse Kaffee
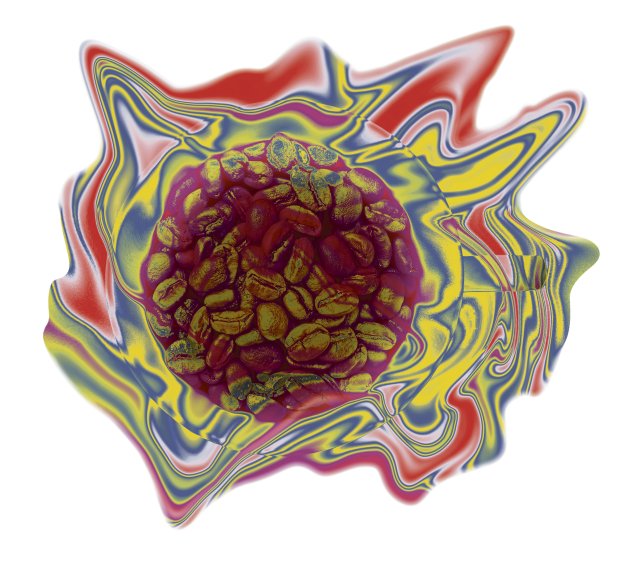
Als ich Kind war, gab es noch Zigarettenwerbung im Fernsehen. Mir sind besonders die Marlboro-Cowboys in Erinnerung, wie sie auf ihren Pferden die Rinder durch die Flüsse trieben. Und abends dann am Lagerfeuer frohgemut entspannten, in der einen Hand die Zigarette, in der anderen einen Becher Kaffee. Daran sieht man: Es ist eine Frage der Konvention, wann man Kaffee trinkt. Viele meinen: Ein Kaffee am Nachmittag, und sie könnten nachts nicht schlafen. In Schweden beispielsweise sieht man das anders und gönnt sich zum Lockerwerden noch ein Tässchen nach dem Abendessen.
In meiner Kindheit wurde mir Malzkaffee zum Kuchen angeboten, wenn die Erwachsenen Bohnenkaffee tranken, wie man damals noch sagte. Beides schmeckte mir überhaupt nicht. Der Malzkaffee war eklig, der Kaffee bitter. Mit dem Rauchen fing ich noch vor dem Kaffeetrinken an, in der neunten Klasse, aus den üblichen Pubertätsgründen. Eigentlich eine der dümmsten Drogen, langfristig sehr teuer, und man merkt kaum etwas außer dem Verlangen, regelmäßig zu rauchen, sonst fühlt man sich ungut. Das ist die schwere Abhängigkeit von der leichten Droge.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Es gibt aber auch das Verlangen, spätestens bis zum Nachmittag Kaffee zu trinken. Anscheinend existiert ein Koffeinspiegel, der nicht absinken darf, so wie der Nikotinspiegel den Raucher*innen zu schaffen macht. Jede Stunde brauchen sie Nachschub, um zu »entspannen«, wie sie sagen. Manche können auch nur rauchen, wenn sie dazu einen Schluck Kaffee trinken. Wenn ich früher mit meiner Freundin verreiste, nahm sie stets ihre Kaffeemaschine mit, die sie in Jugendherbergs- oder Hotelzimmern anwarf, damit sie etwas trinken konnte, wenn sie rauchte. Der doppelte Suchtdruck von »Coffee and Cigarettes«, wie Jim Jarmusch 2003 einen Episodenfilm nannte. Leider ist es in Deutschland nicht möglich, in eine Bar zu gehen, um sich kurz mit einem Espresso zu stärken, denn am Tresen gibt es in der Regel nur Pils oder einen vor circa 100 Jahren aufgesetzten Filterkaffee.
Das Espressotrinken hierzulande galt lange als Zeichen von Luxus und Weltläufigkeit. In den Fußballmagazinen heißt es in Porträts und Interviews mit erfolgreichen Managern und Trainern oft, sie nippten während des Gesprächs an ihrem zweiten Espresso, um ihre Konzentration aufrechtzuerhalten. Wer es sich leisten kann, hat eine Maschine zu Hause – wer nicht, einen dieser Apparate für Pads, die sehr umweltschädlich sind, mit denen sich aber ein gar nicht so schlechter Espresso machen lässt.
Mit dem Kaffeetrinken begann ich erst in der 12. Klasse im Gemeinschaftskundeleistungskurs bei einem linken Lehrer. Bevor der Unterricht losging, wurde erst mal Kaffee gekocht und getrunken. Und dann auch gleich zu Anfang des Schuljahres gemeinschaftlich eine Kaffee-Ausstellung besucht: Wie arm sind die Kaffeebauern? 35 Jahre später schickte mir mein Sohn ein Video aus Peru, wo er eine Kaffeerösterei besucht hatte: »Was ihr da trinkt, ist Müll! Das ist nur der Abfall von unserem guten Kaffee, den wir aber hier trinken«, riefen darin die Peruaner nach Europa. Mein Sohn hatte versucht, im Regenwald Englisch zu unterrichten. Doch die Kinder waren zu nervös, sie kauten Coca-Blätter und tranken Kaffee dazu.
Für mich war die Dosierung lange ein Problem, der Portionslöffel ein ewiges Rätsel: Wie viel Kaffee für wie viele Tassen und: gehäuft oder gestrichen? Im Zweifelsfall einen Extralöffel für den Geschmack, sagten meine Freunde, und dann wurde mir von meinem eigenen Kaffee regelmäßig schwindlig. Da merkte ich erstmals, dass Kaffee eine Droge ist.
Fast untrinkbar war auch das Zeug aus den Espressokochern auf dem Herd: sehr bitter und viel zu stark. Wenn man den Wasserbehälter des Kochers nicht lange genug trocknen lässt, bildet sich Schimmel am Boden, den man nie wieder loswird. Und man meint, der faulige Geschmack rührt daher.
Besser ist der Mokka-Kocher: Weil der Zucker mitgekocht wird, schmeckt’s schön süß. Allerdings darf man das Ding nicht aus den Augen lassen, um es dann kurz vor dem Überkochen vom Herd zu heben. Gilt auch für die Espressokanne, die den ganzen Herd vollsprotzelt, wenn man nicht schnell genug ist. Das passiert bei der elektrischen Espressokanne nie, aber dafür schmeckt’s auch niemals.
Allgemein formuliert sollte Kaffee schmecken und kicken. Wachwerden als Menschwerdung. Der normale Bürokaffee ist da nur Belastung – schwarzes Gold, dass man wider alle Erfahrung aus großen Thermokannen pumpt und das einem regelmäßig den Nachmittag verleidet, eine moorige Suppe, die streng in den Körper fährt und den Kreislauf und/oder den Magen angreift. Der lösliche, langweilige Instantkaffee ist keine Alternative, nur die Wiederholung des immer gleichen Geschmackserlebnisses, dessen Dumpfheit manche Menschen aber als beruhigend empfinden. Dann schon lieber einen »Türkischen« in der Tasse anrühren, bei dem man nicht weiß, ab wann man den Bodensatz abtrinkt.
Beim Sonntagsausflug gibt es fast naturgesetzartig einsetzende Enttäuschungen über »Kaffee-Spezialitäten«, die von vielen Lokalen feierlich auf der Karte offeriert werden. Tatsächlich ist jeder in der Öffentlichkeit bestellte Kaffee, der schmeckt, eine Überraschung.
In den 80er Jahren begannen die Cafés damit, Espressomaschinen zu präsentieren. Café au Lait war das Trendgetränk, serviert in mittelgroßen Schalen, die man beidhändig zum Mund führte, um die vermeintlich französische Lebensart einzuschlürfen, mit einem über der Oberlippe zurückbleibenden Milchbart als Karikatur für solcherlei Kaffeekonsum. Ähnlich war es beim Cappuccino, der meist mit Sahne aus der Sprühflasche aufgefüllt wurde.
Das Recht auf aufgeschäumte Milch wurde von den Café-Betreibern erst beim Latte macchiato anerkannt, der bis heute mit Luxus-Kennermiene weggeschlabbert wird, auch wenn es nur heiße Milch mit einem Schuss Kaffee ist, die in Italien die Kinder bekommen, damit sie sich an Kaffee gewöhnen. In Deutschland gilt ein »Latte« konstant als Getränk der herrschenden Schnöselklasse, die die Städte aufkauft und verteuert. »Kein Becks, kein Latte, kein Bullshit« steht auf der Markise des »Baiz«, einer der letzten anarchistischen Kneipen Berlins.
Einerlei, wie schlecht er auch gekocht wird, Kaffee bleibt ein Distinktionsmerkmal. Lange war ich bei einer kleinen Zeitung tätig, die weit links draußen auf die Massen wartete. Um dabei nicht allzu sehr zu ermüden, experimentierten wir im Kulturessort mit verschiedenen Formen des Kaffeekochens. Irgendwann wurde die stets verklebte und verkalkte Kaffeemaschine durch eine French-Press-Kanne ersetzt, aus der wir dann großzügig auch unseren Kollegen etwas anboten: »Willst du mal etwas anderes erleben? Dann trink doch mal richtigen Kaffee!«
Und auch ich wusste auf einmal, wie ich zu dosieren hatte: Drei Esslöffel für drei Becher. Und dann nicht zu lange ziehen lassen. Das hatte mich ein neuer Kollege gelehrt, der die Literatur machen sollte und sich dabei als Kaffeewissenschaftler entpuppte. Er wusste von zermürbenden Jahren des Selbststudiums zu berichten, bis ihm der Kaffee endlich besser mundete. Deshalb bestimmte er auch die Wahl der Kaffeemarke, die sich am besten für die French-Press-Methode eignen würde. Und ich muss zugeben: Ja, es gibt ihn, den Kaffee, der sogar im Büro schmeckt.
»Wie der erste Kaffee hinter der Grenze« heißt weiterhin das Gütesiegel; einerlei, ob damit Frankreich oder Italien gemeint ist. Die Länder, in denen der Sage nach der Kaffee eigentlich immer schmeckt, zumindest wenn man daran glaubt. Andere glauben an Gott, wir an den Kaffee.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







