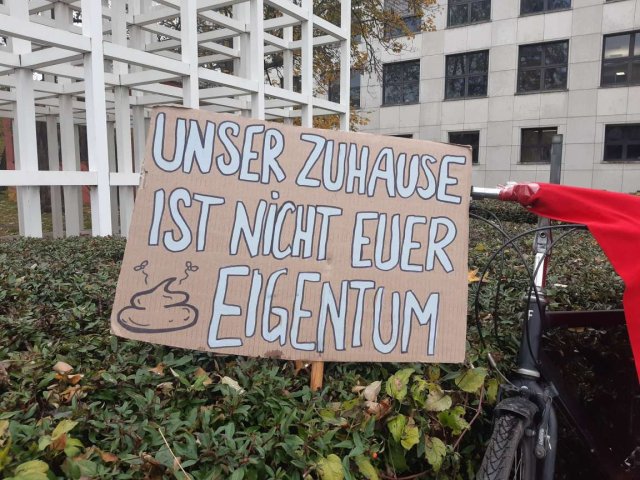- Berlin
- Berliner Rettungsstellen
90 Minuten, bis die Ärztin kommt
In Berliner Rettungsstellen herrschen durchschnittliche Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden

Die Hitze brennt auf der Haut, für die Abkühlung steht der See bereit. Mit Anlauf erfolgt der Sprung ins kalte Wasser – doch dann rutscht der Fuß aus. Statt im See zu landen, fällt der Körper zu Boden, und ein gewaltiger Schmerz zieht sich durch das Bein. Es folgt der widerwillige Gang zur nächsten Rettungsstelle.
Von einem schnellen Service ist in der Berliner Notfallmedizin allerdings keine Rede. Je nach Klinikum müssen Patient*innen, die nicht lebensbedrohlich verletzt sind, im Durchschnitt bis zu eineinhalb Stunden warten, bis sich jemand ärztlich um sie kümmert. Dies ergab eine schriftliche Antwort der Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD), die die landeseigenen Kliniken Charité, Universitätsmedizin Berlin und Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH um Auskunft gebeten hat. Die Anfrage stellte der CDU-Abgeordnete Lars Bocian.
Dass die Wartezeiten überhaupt öffentlich sind, ist eine rare Ausnahme. »Vivantes ist der einzige Krankenhausträger in Berlin, der die Wartezeiten in seinen Rettungsstellen veröffentlicht«, erklärt Christoph Lang, Pressesprecher von Vivantes auf nd-Anfrage. Dessen Daten zufolge müssen Patient*innen für das Klinikum am Urban in Tempelhof-Schöneberg sowie Klinikum im Friedrichshain mit durchschnittlich über 90 Minuten am längsten warten. Kürzer sind die Wartezeiten am Humboldt-Klinikum in Reinickendorf und Klinikum Kaulsdorf in Marzahn-Hellersdorf mit etwa 30 bis 40 Minuten. Auf ihrer Webseite zeigt Vivantes transparent auf, wie die aktuellen Wartezeiten in der Notfallversorgung an seinen sieben Standorten für Rettungsstellen aussehen.
Lang erklärt, dass die transparenten Wartezeiten zur Aufklärung der Patient*innen dienen sollen. Außerdem veröffentlicht der kommunale Krankenhausträger, wie viele Patient*innen mit Rettungswagen gebracht und wie viele lebensbedrohliche Notfälle aktuell behandelt werden. So können Patient*innen aus Nordwestberlin selbst entscheiden, ob sie lieber ins Klinikum Kaulsdorf fahren wollen, weil sie dort aktuell nur 27 Minuten warten müssen, oder lieber eine kurze Strecke bevorzugen und ins Klinikum Spandau fahren, wo die Wartezeit 51 Minuten beträgt.
Sowohl Lang von Vivantes als auch Marc Schreiner von der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) betonen allerdings, dass jede*r Patient*in nach Eintreffen in die Rettungsstelle unverzüglich vom medizinischen Fachpersonal angesehen und dessen Dringlichkeit eingeschätzt wird.
»Lebensbedrohliche Notfälle haben immer Vorrang und werden sofort behandelt«, erklärt Christoph Lang. Dies könne dazu führen, dass Fälle mit Beinbruch oder Rückenschmerzen im Schnitt länger warten müssten.
Dass dies frustrierend für Patient*innen sein kann, räumt Geschäftsführer Marc Schreiner von der BKG ein. »Das ist nicht schön für die Patienten, aber für den Ablauf im Krankenhaus ist dieser Vorgang selbstverständlich«, erklärt er »nd«. Er appelliert für mehr Verständnis: »Es wäre ja absurd, wenn ein Schlaganfallpatient erst nach einem Patienten mit Schmerzen im Knie behandelt würde, nur weil dieser bereits seit zwei Stunden wartet.«
»Die Rettungsstelle sollte die letzte Eskalationsstufe sein.«
Marc Schreiner
Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft
Verständnis ist derweil nicht das Einzige, was von Patient*innen gefordert wird. Schreiner verlangt auch mehr Eigenverantwortung und präventive Gesundheitsversorgung. So können dem BKG-Chef zufolge 70 Prozent aller Betroffenen, die in der ambulanten Versorgung landen, nach ihrer Behandlung wieder nach Hause gehen. Das seien oft Fälle, die nicht zwingend in Rettungsstellen hätten behandelt werden müssen, wenn sie sich vorab anderweitig selbst versorgt hätten.
»Was wir brauchen, ist eine bessere Steuerung der Patienten«, sagt er. »Außerdem brauchen wir eine höhere Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung.« Denn viele Menschen würden zu lange warten, bis sie Schmerzen oder Probleme behandeln lassen. Deshalb sollten sich Patient*innen bereits präventiv gesund ernähren und leben, außerdem schon bei anfänglichen Symptomen untersuchen lassen und »nicht erst dann kommen, wenn es wirklich schlimm wird.«
Die erste Stufe sollten Hausmittel oder Medikamente aus der Apotheke sein. »Wenn das nicht hilft, sollen Haus- oder Fachärzte aufgesucht werden, besonders bei langsam entwickelnden Erkrankungen.« Im Akutfall gäbe es den ärztlichen Notdienst und den Patient*innenservice, welcher unter der Nummer 116 117 zu erreichen ist. Diese würden Ärzt*innen zu einem nach Hause schicken oder die Betroffenen an behandlungsbereite Praxen vermitteln. »Die Rettungsstelle sollte die letzte Eskalationsstufe sein, wenn eine unmittelbar schwerwiegende Erkrankung oder Notfall vorliegt.«
Langfristig wäre eine Investition des Landes Berlin notwendig, erklärt Schreiner. Denn dem BKG-Chef zufolge wurde die Finanzierung von Rettungsstellen und Krankenhäusern stark vernachlässigt. »Es gibt in Berliner Krankenhäusern einen Investitionsbedarf von 3,5 Milliarden Euro für 2020 bis 2030«, sagt er. Das sind 350 Millionen Euro pro Jahr, doch den Krankenhäusern wird lediglich 190 Millionen zur Verfügung gestellt. »Das sind keine Wünsch-dir-was-Investitionen, Krankenhäuser haben sogar einen Rechtsanspruch auf diese Summe. Aber das Abgeordnetenhaus und der Senat geben uns derzeit zu wenig«, so Schreiner.
Oliver Fey, Pressesprecher des Gesundheitssenats, verweist indes auf sogenannte »Richtlinien der Regierungspolitik«: Der Senat setze sich mit Nachdruck für einen Ausbau des Angebots an Notdienstpraxen im gesamten Stadtgebiet ein. Schließlich sei das Ziel, dass alle Bürger*innen rund um die Uhr bedarfsgerecht versorgt werden. Die Gesundheitssenatorin Ina Czyborra erklärt »nd«, dass ihr dabei wichtig sei, »dass jene Menschen in einer Rettungsstelle schnellstmögliche Hilfe bekommen, die diese am dringendsten brauchen«. Die Wartezeiten bei weniger dringenden Fällen empfindet sie in der dargestellten Höhe derweil für hinnehmbar.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.