- Politik
- Landtagswahlen
AfD-Umfragewerte: Destruktiver Ersatz
Der Humangeograf Dominik Intelmann über die Rolle von Eigentumsverhältnissen für den Rechtsruck im Osten

Sie verweisen bei den Gründen für die angespannte politische Lage in Ostdeutschland auf die Rolle der politischen Ökonomie. Wodurch ist diese im Osten geprägt?
Mit der Wiedervereinigung wurde das ehemalige Volkseigentum der DDR umverteilt. Etwa 85 Prozent des Wertes der Produktionsmittel gingen an westdeutsche Privateigentümer*innen, etwa 10 Prozent an ausländische und etwa 5 Prozent an ostdeutsche. Dieser Entwicklungspfad hat Ostdeutschland zu einer Region ohne lokale Bourgeoisie gemacht, die bis heute von westdeutschen Entscheidungen und Transferleistungen abhängig ist. Eine eigenständige Entwicklung wurde nahezu unmöglich gemacht.
Worin zeigt sich das?
Dies zeigt sich unter anderem darin, dass es in Ostdeutschland kaum Unternehmenssitze gibt, sondern vor allem abhängige Filialen von Großunternehmen, die ihren Sitz überwiegend in Westdeutschland haben. Diese lassen im Osten weniger produktive Produktionsschritte durchführen, die mehr auf handwerklichen und mechanischen Tätigkeiten und weniger auf Forschung und Entwicklung basieren. Mit dieser räumlichen Verteilung sind viele Phänomene verbunden: Löhne, Tarifbindung, Mitbestimmungsregelungen, gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Gewerbesteuern für die Kommunen und Qualifizierungsmöglichkeiten der Beschäftigten sind im Osten vergleichsweise gering. Zudem erlaubt es diese Struktur den Konzernzentralen, ihre ostdeutschen Filialen einfach ins Ausland zu verlagern. Damit wurde bei Forderungen nach mehr Lohn lange Zeit gedroht.
Wie aktuell sind diese Prozesse?
In der derzeitigen Debatte um Ostdeutschland hat man häufig den Eindruck, es ginge lediglich um Kränkungen und Einschnitte der 1990er Jahre, die nun nur noch über Erzählungen kulturell an die nächste Generation weitergegeben werden. Die konkreten Erfahrungen, die mit diesen Eigentumsverhältnissen verbunden sind – Ohnmacht, fehlende Handlungsfähigkeit und Fremdbestimmung –, werden im Alltag jedoch immer wieder neu gemacht. Sie bestimmen die Chancen und prägen die Alltagserleben.
Was sind die Folgen dieser Bedingungen?

Dominik Intelmann promoviert an der Goethe-Universität Frankfurt am Mainam Institut für Humangeographie zu lokalen Entstehungsbedingungen politischer Einstellungsmuster am Beispiel von Chemnitz und Leipzig und beschäftigt sich mit der politischen Ökonomie Ostdeutschlands und ihren Folgen. Er ist in Chemnitz aufgewachsen und führt kritische Stadtrundgänge im Fritz-Heckert-Gebiet und Leipzig-Grünau durch.
Im betrieblichen Bereich sprach man in den 1990er Jahren von den ostdeutschen »Arbeitsspartanern«. Die damit zum Ausdruck gebrachte Bescheidenheit und Angepasstheit war eine Reaktion der Beschäftigten auf eine Zwangssituation. Sie gingen davon aus, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren würden, wenn sie streiken oder mehr fordern würden. Diese Einstellung hat sich lange gehalten – aber auch die Bedingungen, unter denen sie entstanden ist. Demokratische Institutionen sind in Ostdeutschland zwar nominell vorhanden, aber sie sind alle durch eine strukturelle Schwäche gekennzeichnet – das gilt für die Arbeitgeberverbände ebenso wie für die Gewerkschaften. Das hat auch dazu geführt, dass die Ostdeutschen bis heute tendenziell weniger auf Partizipation vertrauen. In der Lebenswelt vieler Ostdeutsche gibt es nur wenige Bereiche, in denen sie sich wirksam einbringen können – und die Bereiche, in denen sie es können, wie etwa die Quartiersmanagements in den Plattenbaugebieten, haben sich als Orte der Symbolpolitik und der Farce erwiesen.
Warum wählen so viele Ostdeutsche dann gerade die AfD?
Die bereitgestellten Partizipationskanäle haben sich im Alltag der Ostdeutschen als eher wirkungslos erwiesen. Das Angebot der AfD und anderer extrem rechter Parteien verspricht Handlungsfähigkeit. Nach dem Psychologen Klaus Holzkamp kann man Handlungsfähigkeit auf zwei verschiedene Arten herstellen: als verallgemeinerte, solidarische Handlungsfähigkeit, die darauf abzielt, dass alle mehr Handlungsfähigkeit gewinnen – oder als restriktive Handlungsfähigkeit unter Akzeptanz von Konkurrenzverhältnissen, bei der es darum geht, auf Kosten anderer handlungsfähig zu werden. Solidarischem Handeln in diesem Sinne trauen viele im Osten keine Wirksamkeit mehr zu. Restriktive Handlungsfähigkeit erscheint hingegen als die einzig realistische. Und dieses Angebot macht unter anderem die AfD.
Aber die AfD stellt eben doch die Eigentumsverhältnisse nicht infrage. Warum kann gerade sie davon profitieren?
Handlungsfähigkeit ist in den gegebenen Verhältnissen maßgeblich mit der Kontrolle über Privateigentum verbunden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Die Philosophin Eva von Redecker macht darauf mit dem Begriff des »Phantombesitzes« aufmerksam, den sie insbesondere für die Analyse des Patriarchats geprägt hat. Demnach suchen Menschen, die strukturell besitzlos sind, nach Ersatz für dieses Vorenthaltene: das Erleben von Kontrolle, wie es das Privateigentum verspricht. Übertragen heißt das: Wir sollten viel intensiver beobachten, was die strukturelle Eigentumslosigkeit für das Alltagserleben Ostdeutscher bedeutet. Ich finde es sehr naheliegend, dass die AfD, die Freien Sachsen und weitere Momente von Handlungsfähigkeit ermöglichen, die einen Ersatz darstellen. Das beginnt bereits, wenn Menschen darüber bestimmen wollen, wie sich vermeintliche Ausländer*innen bewegen oder wo sie sich aufhalten dürfen.
Gibt dabei kein Bewusstsein für die reale ungerechte Eigentumsverteilung?
Ja, ich höre in Gesprächen immer wieder: »Stimmt, der Reichtum ist ungerecht verteilt, aber an die Reichen kommt man nicht ran.« Der Zugriff auf den vorhandenen Reichtum wird als unmöglich angesehen. Worüber sie stattdessen vermeintlich verfügen können, sind dann proletarisierte Migrant*innen und Ausländer*innen, die in der Nähe leben – ein Ausdruck von Phantombesitz.
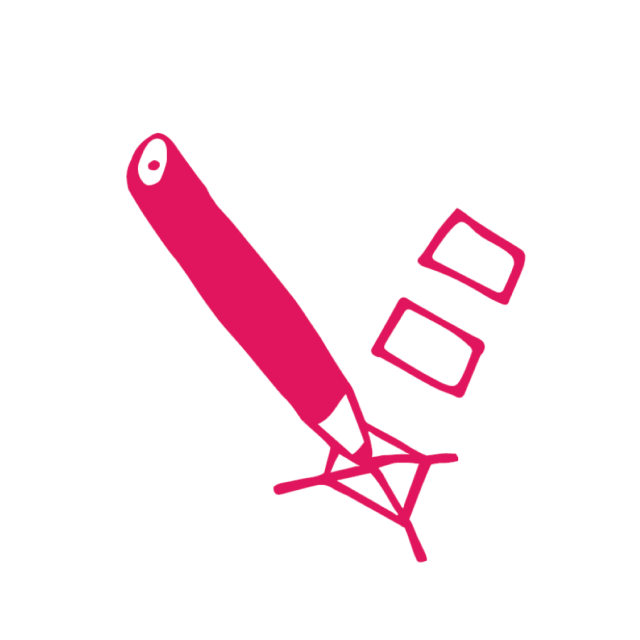
Das Wahljahr 2024 ist kein beliebiges. Schon lange nicht mehr war die Zukunft der Linken so ungewiss, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren die politische Landschaft und die Wählerschaft so polarisiert, noch nie seit der NS-Zeit war eine rechtsextreme, in Teilen faschistische Partei so nah an der Macht. Wir schauen speziell auf Entwicklungen und Entscheidungen im Osten, die für ganz Deutschland von Bedeutung sind. Alle Texte unter dasnd.de/wahljahrost.
Warum wird eine solidarische Antwort als unmöglich betrachtet?
Da ist zum einen die historische Erfahrung der DDR, das Scheitern des Realsozialismus. Das Versprechen war ja, dass eine Gesellschaft der sozialen Gleichheit möglich ist. Durch das Scheitern glauben viele nicht mehr an die reale Möglichkeit einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft. Zum anderen spielt die bis heute erlebte Wirkungslosigkeit in den angebotenen demokratischen Kanälen eine Rolle.
Konnte die PDS und später die Linke nicht etwas erlebte Solidarität im Osten ermöglichen?
Auch die Linkspartei hatte lange Zeit die Funktion, den Ostdeutschen einen Ersatz zu bieten – zumindest eine ostdeutsche Identität konnte durch sie stabilisiert werden. Langfristig konnte unter der Bedingung ostdeutscher Abhängigkeit eine selbstgesteuerte solidarische Politik aber kaum gemacht werden. Ideen von Vergesellschaftung wurden zwar geäußert, konnten aber nie real erlebt werden.
Was ist mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, das zwar im Osten erfolgreich ist, aber ebenfalls die Eigentumsfrage nicht stellt?
Es geht nicht mehr darum, wie bei der Wahl der PDS oder später der Linken, die Frage nach Systemalternativen zu stellen und die Gesellschaft verändern zu wollen. Die Wähler*innen wollen mittels des BSW eine Art Kraftprobe machen. Die gesamte Politik des BSW ist bisher hochsymbolisch – aber das ist auch das Maximum, an das viele Ostdeutsche noch glauben können. Eine Antwort auf ihre sozialen Probleme erwarten sie nicht mehr. Ohne das BSW direkt mit der AfD vergleichen zu wollen: Beide versprechen Macht, ohne die Eigentumsfrage zu stellen.
Seit einiger Zeit gibt es politökonomische Veränderungen in Ostdeutschland: Große Unternehmen wie Intel und Tesla siedeln sich an, dazu nehmen auch gewerkschaftliche Kämpfe in einigen Branchen zu. Müsste das nicht demokratische Positionen stärken?
Die Menschen verdienen vielleicht etwas mehr Geld als früher, aber der prägende Mangel an Mitbestimmung und die Abhängigkeiten bleiben tendenziell bestehen. Bei den Großansiedlungen wird klar, dass die ostdeutschen Peripherien als Orte genutzt werden, die allseitig ausbeutbar sind. Tesla-Chef Elon Musk lehnt Gewerkschaften in seinem Werk in Grünheide ab, es geht die Angst vor Wasserknappheit um. Die Aussicht auf eine lokale und demokratische Verfügung über Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort ist weiterhin schlecht. Und ja, die Zeiten des ostdeutschen »Arbeitsspartaners« sind aufgrund des Fachkräftemangels vorbei. Die Arbeitnehmer*innen können dadurch neue Kraft gewinnen – aber die Eigentumsverhältnisse und die schwachen Partizipationskanäle bleiben unverändert. Ostdeutsche stoßen bei allen erkämpften Verbesserungen immer wieder an die gläserne Decke des Eigentums.
Wo wären theoretisch Stellschrauben für eine emanzipatorische Entwicklung?
Früher haben alle Parteien versucht, die Entstehung einer ostdeutschen Eigentümerklasse zu befördern, die eine selbsttragende Wirtschaftsentwicklung ermöglicht. Damit sind sie gescheitert. Ostdeutschland ist auf unabsehbare Zeit von Transfers abhängig. Eine emanzipatorische Antwort hieße Vergesellschaftung. Die Forderung nach Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin durch die Kampagne »Deutsche Wohnen & Co enteignen« ist für die Berliner*innen einleuchtend, sie knüpft an ihr direktes Bedürfnis an. Doch etwa in Sachsen lässt sich mit der Forderung nach Vergesellschaftung keine Mehrheit begeistern. Angesichts eines globalen Rechtsrucks ist es keineswegs nur eine ostdeutsche Frage: Welcher Weg führt von der destruktiven Ersatzstruktur hin zu einem Alltagsleben, das die Menschen tatsächlich selber formen können?
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







