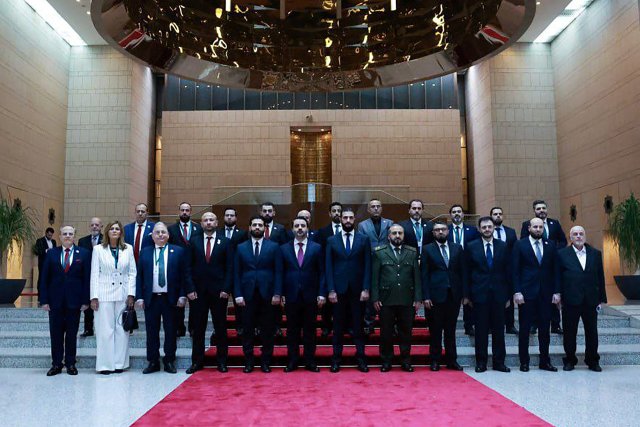- Politik
- Linke in Israel
»Wer die Geschichte versteht, kann auch die Realität verändern«
Unterwegs in Tel Aviv, Jaffa und Jawne ein Jahr nach dem 7. Oktober mit israelischen Linken aus den Organisationen Zochrot und Radical Block

Von der Moschee, die hier mal stand, ist nur noch das Minarett übrig. Der steinerne Turm steht auf einem kleinen Hügel, von dem wir über die modernen Hochhäuser der Stadt Jawne blicken. Jawne hieß früher Jibna. Eine kleine Stadt, eine halbe Stunde südlich von Tel Aviv und Jaffa, die für ihre Olivenbäume und Zitrusfrüchte bekannt war. Auf einem Hügel, nahe der Küste gelegen, hatte sie eine strategisch wichtige Position entlang der alten Eisenbahnstrecke Gaza–Lydda (heute: Lod). Früher, das heißt vor 1948, vor der Nakba. Von den palästinensischen Häusern sind bis auf das Minarett und einer weiteren Moschee, die inzwischen als Synagoge genutzt wird, kaum welche übrig. Von den Familien auch nicht. Nachdem die zionistischen Milizen damals die Stadt eingenommen hatten, vertrieben sie die 6000 Bewohner*innen Richtung Süden.
Tomer, ein 26-jähriger Israeli aus Haifa, zeigt mir Bilder vom Hügel vor 1948. Eine Moschee inmitten eines dichten Geflechts von Steinhäusern. »Die Häuser wurden schon in den ersten Monaten nach der Nakba zerstört. Das mamlukische Minarett ist aus dem 14. Jahrhundert.« Es ist der einzige Teil der Moschee, der die Sprengung durch die israelische Armee 1950 überdauert hat. Wo heute ein Park ist, war früher ein Friedhof. Tomer deutet den kleinen Abhang direkt neben der Moschee hinunter und schüttelt den Kopf: »Behandelt man so etwa das Heilige Land?«
Nakba bedeutet Katastrophe auf Arabisch. Über 700 000 Palästinenser*innen mussten zwischen Dezember 1947 und Januar 1949, vor allem aber im Sommer 1948 aus ihrer Heimat fliehen oder wurden von zionistischen Milizen vertrieben. Für die einen, viele Überlebende des Holocaust, bedeutete die Gründung des Staates Israel endlich eine sichere Zuflucht vor Verfolgung und Vernichtung. Für die anderen bedeutete sie Vertreibung und Entwurzelung aus der eigenen Heimat.
Bis auf wenige Gebäude und Erinnerungen gibt es vielerorts kaum noch Spuren des palästinensischen Lebens vor 1948: Die osmanischen Steinhäuser wurden durch moderne Siedlungen oder Kibbuzim ersetzt, palästinensische Orts- und Straßennamen durch hebräische. »In Jawne kann man musterhaft sehen, wie die Judaisierung funktioniert hat«, sagt Tomer. Im Oktober 1948 wurde hier ein Transit-Camp für Jüd*innen errichtet, die aus anderen arabischen Ländern vertrieben wurden oder aus Europa flohen. Auf Vertreibung folgt Vertreibung. Und dennoch wird man hier und da Spuren der Vergangenheit finden, wie das Minarett in Jawne.
Wichtiges Erinnern
Tomer ist einer, der auf Spurensuche geht. Rund 250 entvölkerte palästinensische Dörfer hat er schon auf eigene Faust besucht, meistens am Wochenende, wenn er frei hat. Oft lädt er Freund*innen und Interessierte zu diesen Ausflügen ein. Dieses Mal sind wir eine gemischte Gruppe aus israelischen, palästinensischen und deutschen Linken und fahren in Kolonne hinter Tomer her. Er ist Antizionist und Community-Member der israelisch-jüdischen Organisation Zochrot. Zochrot bedeutet »Wir erinnern uns«. Die Organisation stellt Bildungsmaterial zur Nakba und dem Recht auf Rückkehr auf Hebräisch bereit, um insbesondere in der jüdischen Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die gewaltvolle Gründungsgeschichte Israels zu schaffen. Damit wollen sie die Grundlage für die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und ein gemeinsames Leben in Israel/Palästina schaffen. Ihre Arbeit ist alles andere als selbstverständlich: Wenige Israelis wissen von der palästinensischen Geschichte ihrer heutigen Wohnorte und der gewaltvollen Vertreibung Hunderttausender durch die zionistischen Milizen, die mit der israelischen Staatsgründung Israels einherging. Und der Staat tut alles dafür, sie vergessen zu machen.
Zochrot (Hebräisch: Wir erinnern uns) ist eine israelische Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Nakba 1948 als zentrales Ereignis des israelisch-palästinensischen Konflikts in den jüdisch-israelischen Diskurs einzuführen. Das Ziel: Durch Dokumentationen und Besichtigungen eine selbstkritische Reflexion über die Nakba sowie die Flüchtlings- und die Rückkehrfrage anzustoßen. Mit der von Zochrot entwickelten App iNakba können sich Nutzer über palästinensische Orte informieren, die während und infolge der Nakba seit 1948 zerstört wurden.
https://www.zochrot.org
»Für mich ist das Erinnern wichtig«, sagt Tomer. »Es ermöglicht uns, die ethnische Säuberung zu sehen, die das gesamte israelisch-palästinensische Gebiet geprägt hat. Bis heute wird den Flüchtlingen ihre Rückkehr verweigert, bis heute gibt es immer neue Flüchtlinge. Nur wenn wir die Geschichte und auch ihre kolonialen Aspekte verstehen, können wir daran arbeiten, diese schreckliche Realität zu verändern.« Die Lösungen müssen für ihn auf Wahrheit und Gerechtigkeit beruhen. Während Tomer und ich uns unterhalten, sehen wir am Himmel Militärhubschrauber nach Süden, also Richtung Gaza, fliegen.
Anders als im Norden Israels, wo es eine Vielzahl palästinensischer Städte gibt, wurden die Palästinenser*innen im Süden mehrheitlich in den Gazastreifen vertrieben. In den dortigen Flüchtlingslagern heißen deswegen ganze Straßenzüge nach den alten Dörfern. Aus Jibna sind die meisten Vertriebenen in Rafah gestrandet. »Ihre Nachfahren leben immer noch dort«, erzählt Tomer. »Wenn sie noch am Leben sind.« Größtenteils blieb die gesamte Gemeinschaft zusammen. Deshalb heißt ein Teil des Flüchtlingslagers in Rafah Jibna-Camp. Da die Familien wuchsen und der Platz in Gaza beschränkt ist, bauten sie die Häuser immer weiter in die Höhe, damit die ganze Familie zusammen unterkommen konnte. So kann ein einziger israelischer Bombenangriff eine gesamte Familie mit bis zu 50 Mitgliedern auf einmal auslöschen.
Zwischen Verdrängung und Trauma
Zurück in Tel Aviv. Ich spaziere an der Strandpromenade zwischen Jaffa und Tel Aviv entlang. Das Meer ist ruhig – trotzdem spüre ich Beklemmung. Gaza ist nur eine Stunde Luftlinie von hier entfernt. Die Wellen sind die gleichen, die sich auch am Strand in Beit Lahia brechen. Nur wenig erinnert im Tel Aviver Alltag an die unbeschreibliche Katastrophe dreißig Kilometer weiter südlich, wo ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht werden und die dauerhafte Vertreibung der Bevölkerung im nördlichen Teil des Gazastreifens in diesem Moment Realität wird. Und auch in den Medien spielen weder die Kriegsverbrechen der israelischen Armee noch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung eine Rolle: Es scheint, als gäbe es die Hamas, die Geiseln und die Soldaten in Gaza, aber keine Zivilist*innen.
Die Bars sind voll, und wer die Möglichkeit dazu hat, verdrängt, was um ihn herum passiert. Raketenalarm unterbricht regelmäßig diese scheinbare Normalität, doch Tel Aviv gilt als sicherster Ort in Israel/Palästina. Routiniert laufen die Menschen in den nächstgelegenen Bunker oder Keller, sitzen mit den Kindern im Arm auf dem Boden und gehen nach wenigen Minuten wieder raus, zurück zum Kaffee, zur Arbeit, zum Arzt. Die Sirenen gehören auf ihre Art zum Alltag. Doch natürlich bedeutet jeder Alarm Stress und die Angst vor Anschlägen steigt. Auch hier wird der Krieg seine Wunden und Traumata hinterlassen.
Über mir fliegt am Abendhimmel ein Militärhubschrauber. Direkt unter meinen Füßen liegt eine von sechs zerstörten palästinensischen Ortschaften. Manschija war früher ein Teil Jaffas. Heute ist von dem Viertel nichts mehr übrig als eine Moschee und dem Etzel-Museum direkt am Strand, das der Eroberung von Manschija gedenkt. Vor mir liegt der Hafen von Jaffa. Als einer der ältesten Häfen der Welt hatte Jaffa lange Zeit eine strategische Funktion für Handel und Militär. In den späten 1940er Jahren lebten in der Stadt über 70 000 palästinensische Araber*innen und 30 000 Jüd*innen. Nach dem UN-Teilungsplan war es als Enklave des arabischen Staates innerhalb des jüdischen Staates vorgesehen.
Die Gewalt der Nakba führte auch in Jaffa zu einem Exodus der palästinensischen Bewohner*innen. Über den Hafen, von dem zuvor vor allem die berühmten Jaffa-Orangen in die Welt verschifft wurden, verließen viele, vor allem die Mittelschicht, die Stadt Richtung Süden, nach Gaza. Migration war damals schon eine Klassenfrage. Wer es sich leisten konnte, ging nach Gaza oder Beirut – in der Hoffnung auf ein sicheres Leben. Die meisten sahen Jaffa nie wieder.
Seit dem 7. Oktober ist es in Jaffa und vielen anderen sogenannten gemischten Städten vergleichsweise ruhig. Die Menschen haben Angst, viele ziehen sich in ihre Communities zurück. Die Repression gegenüber den palästinensischen Einwohner*innen Israels hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen, vor allem nach dem 7. Oktober. Hinzu kommt die Unsichtbarmachung der palästinensischen Identität. Palästinenser*innen, die innerhalb der Grünen Linie, also der Waffenstillstandsgrenze von 1949 und damit innerhalb des israelischen Staats leben, werden meistens als Araber und nicht als Palästinenser bezeichnet. Das ist Teil der Spaltungsstrategie: Der israelische Staat tut alles, um zu verhindern, dass eine geeinte politische Bewegung in der Westbank, im Gazastreifen und von Palästinenser*innen in Israel entsteht. Innerhalb der israelischen Staatsgrenzen sind Ausgrenzung und Unsichtbarmachung der palästinensischen Bevölkerung ein Mittel zur Spaltung, außerhalb sind es Vertreibung und tödliche Gewalt. Nicht umsonst ist deshalb ein Symbol des palästinensischen Widerstands die Kaktusfeige. Ihre Sträucher markieren noch heute die Grenzen vieler Dörfer, die vor 1948 palästinensisch waren oder bis heute sind und stehen für Resilienz, Geduld und Ausdauer.
Die deutsche Linke sollte gegen die Politik der Bundesregierung kämpfen, statt sich in identitären Diskussionen über Nahost zu verlieren.
-
Unsichtbar bleiben meist auch die Ängste und der Schmerz, den der Krieg in Gaza für sie bedeutet. Gerade in Jaffa haben viele Menschen Angehörige in Gaza. Und sind als Teil der israelischen Gesellschaft tagtäglich mit den Verantwortlichen der Kriegsverbrechen konfrontiert. Man trifft sie im Aufzug, wenn sie vom Fliegereinsatz aus Gaza zurückkommen. Oder am Strand, die M16 geschultert. So erzählt mir Rami, ein 31-jähriger Palästinenser, der in Tel Aviv lebt, von seinem Chef. Dieser kämpft derzeit als Reservist in Gaza: »Er denkt, er sei ein moralischer Mensch. Er isst vegan und würde keinem Hühnchen was zuleide tun. Aber er hat kein Problem damit, Bomben über Schulen abzuwerfen, die Dutzende Kinder töten.« Und am nächsten Tag sitzen sie zusammen im Büro.
Für das Überleben der Geiseln
Es ist Samstagabend. Wie jeden Samstag seit mehr als einem Jahr versammeln sich die Angehörigen der Geiseln und Tausende weitere Demonstrierende vor dem Verteidigungsministerium im Zentrum Tel Avivs. Schon von Weitem hört man die verzweifelte Stimme einer Angehörigen aus dem Verstärker: »Geisel-Deal! Geisel-Deal! Geisel-Deal«, die sich in ihrer anschließenden Rede für ein solches Abkommen ausspricht. Fast alle tragen T-Shirts mit Slogans wie »Bring them home« oder einer gelben Schleife, dem Symbol des Kampfes fürs Überleben der Geiseln. Viele haben Schilder mit Fotos von Geiseln dabei. Die meisten schwenken Israelfahnen. Nur ein kleiner Block am Ende der Kundgebung hat Schilder dabei, die den Krieg oder die Besatzung verurteilen. Die Reden der Geiselangehörigen sind berührend. Das Trauma des Massakers sitzt nach wie vor tief. »Du bist nicht allein, wir sind mit dir«, rufen die Demonstrierenden einer Angehörigen Mut zu. Ihre Anstrengung, das Schicksal der Geiseln nicht zu vergessen, spiegelt sich im Stadtbild wider: Deren Gesichter säumen unzählige Hauswände, Kneipen und Straßenecken.
»Heute ist die Demo relativ klein«, sagt Jonathan. Er ist Aktivist und eigentlich jedes Wochenende auf einer der Demos für einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen anzutreffen. Wir kennen uns vom Politikstudium in Berlin, seit ein paar Jahren lebt er wieder in Tel Aviv. Davor war er wie fast alle Israelis in der Armee, heute unterstützt er Menschen beim Verweigern. Mit anderen Aktivist*innen zusammen hat er den »radical block TLV« gegründet, eine mehrheitlich jüdisch-israelische linksradikale Gruppe, die sich im Jahr zuvor während der Proteste gegen die Justizreform formiert hat. Für sie war klar: Nicht nur die rechtsextreme Regierung, sondern auch die Besatzung und das im gesamten israelisch-palästinensischen Raum wirksame Apartheidsystem müssen verschwinden. Sie waren es, die die Forderung nach einem Geiseldeal von Anfang an mit der Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand verknüpft haben. Denn in den großen Demos der Geiselfamilien findet das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza nur selten Erwähnung. Viele Kundgebungen des »radical block« gegen den Krieg in Gaza endeten mit Gewalt: Rechte Israelis spuckten die Aktivist*innen an, rissen ihnen die Transparente weg oder verprügelten sie. Seit dem 7. Oktober haben viele allein aufgrund eines Social-Media-Posts ihren Job verloren oder wurden wegen Terrorismusunterstützung inhaftiert – vor allem letzteres trifft Palästinenser*innen ungleich stärker.
Der »Radical Block TLV« wurde von linksradikalen Aktivist*innen während der Proteste gegen die Justizreform Anfang 2023 gegründet. Ihre Strategie war es, sich dem Mainstream-Protest anzuschließen, diesen gleichzeitig zu stören und die Botschaft zu vermitteln, dass eine Rückkehr zum Status quo nicht ausreichen würde. Der »Radical Block TLV« verbindet die Kritik an der rechtsradikalen Regierungskoalition mit der Forderung nach dem Ende der Besatzung und Apartheid.
»Inzwischen haben wir immer häufiger das Gefühl, dass die Demos nichts bringen. Netanjahu ist es egal, dass wir hier stehen. Oft sitzt er nur wenige Meter entfernt im Verteidigungsministerium und plant mit dem Kriegskabinett die nächsten Verbrechen in Gaza.« Trotzdem geht Jonathan weiter auf die Straße. Immer wichtiger wird neben den Demonstrationen jedoch die konkrete Solidaritätsarbeit in der Westbank, wo die Angriffe und Landnahme von Siedler*innen seit dem 7. Oktober immens gestiegen sind. Jonathan und seine Genoss*innen unterstützen deshalb eine palästinensische Gemeinde, in deren Olivenhainen derzeit ein Rechter zu siedeln begonnen hat. Das Militär lässt den Siedler gewähren. Einmal in der Woche fahren sie in Schichten aus Tel Aviv in das Dorf, um zum Beispiel die Ernte zu unterstützen. Wenn sie als Israelis vor Ort sind, trauen sich die Siedler und das Militär weniger, direkt die Community anzugreifen. Das schafft Solidarität und politisiert den Konflikt.
Wie viele andere Linke denkt Jonathan darüber nach, Israel zu verlassen. »Es gibt hier keine Zukunft mehr«, sagt er. Ein Waffenstillstand ist auch nach der Tötung des Hamas-Anführers Jahja Sinwar nicht in Sicht und erst recht kein Frieden mit gleichen Rechten für alle und einem Ende der Besatzung. Die Zustimmung zu Netanjahu ist so hoch wie seit dem 7. Oktober nicht mehr. Die Linke ist zu schwach, um die israelische Regierung zur Beendigung des Krieges zu zwingen. Deshalb setzt Jonathan auf internationalen Druck. Der muss vor allem auch aus Deutschland kommen: Die Bundesregierung unterstützt den Krieg durch Geld, Waffen und Diplomatie. Es sei an der deutschen Linken, dagegen zu kämpfen, statt sich in identitären Diskussionen über Nahost zu verlieren.
Zurück in Jawne. Neben dem Minarett beginnt Tomer ein Gespräch mit einem etwa 40-jährigen orthodoxen Israeli. Er sitzt in der Sonne auf einem Stein, isst Sonnenblumenkerne und hält in den Fingern eine muslimische Gebetskette. Im Auto zurück nach Tel Aviv berichtet Tomer von dem Gespräch: Der Mann hat als Reservist der Infanterie in Gaza gekämpft. Die Gebetskette habe er aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt mitgenommen. Zu Hause habe er noch dreißig weitere.

Hier in Jawne kommt wie so oft in Israel/Palästina alles zusammen. Die Verflechtung von Holocaust und Flucht der Überlebenden nach Palästina mit der Staatsgründung Israels und der Vertreibung eines anderen Volkes, der Palästinenser, in den Gazastreifen. Das Minarett, um das herum ein neuer Wohnkomplex entstehen soll. Am Fuß des Minaretts ein ehemaliger israelischer Soldat, der eine Gebetsketten wie eine Trophäe trägt, die mutmaßlich von Toten aus Gaza stammt. Und Tomer, der die Spuren dieser Geschichte von Trauma und Gewalt zusammensucht und gegen das Vergessen kämpft.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.